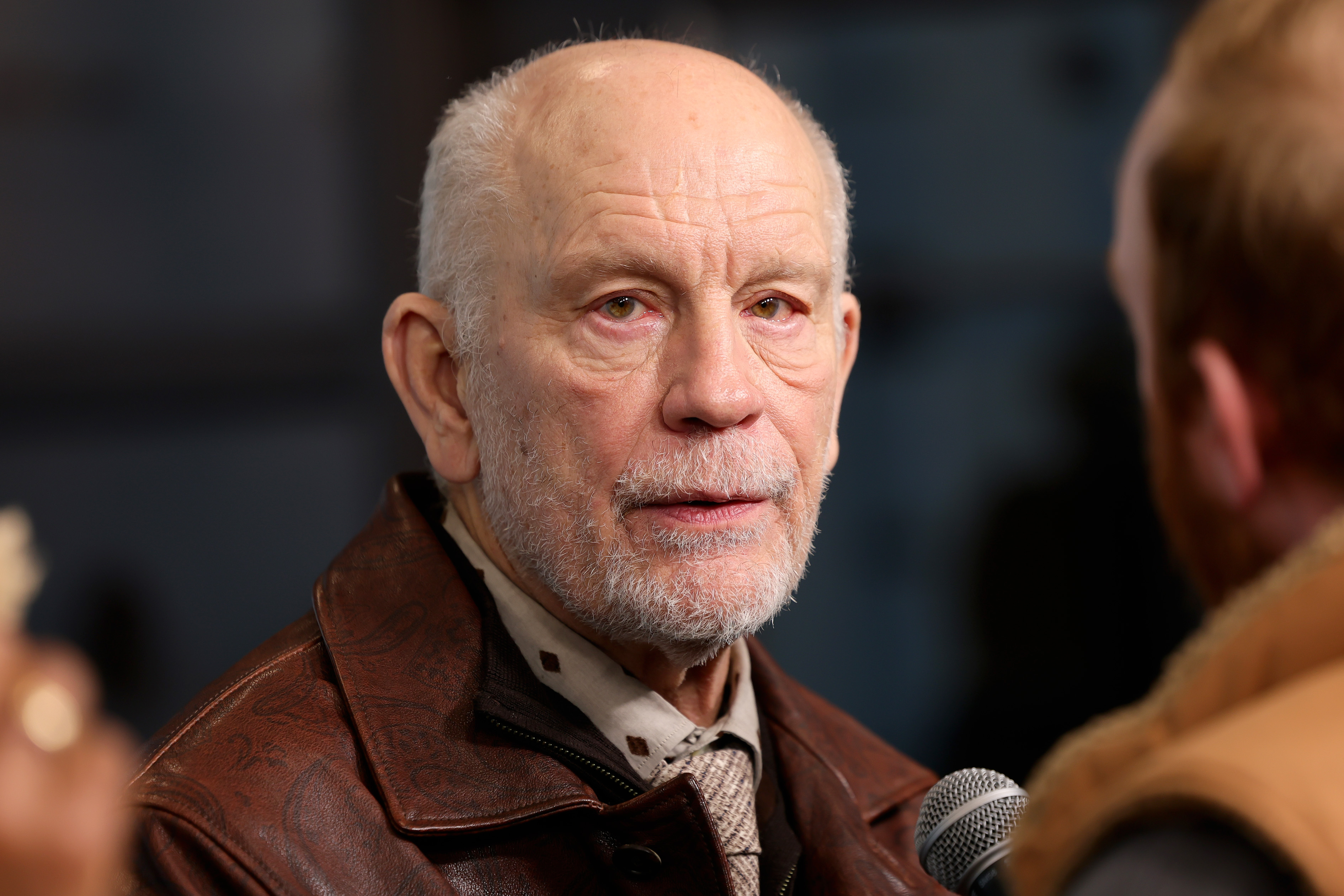Wie The Rolling Stones zur größten Rockband der Welt wurden
Mehr als ein Jahrzehnt machten die Rolling Stones die Rockmusik zu dem, was man heute unter ihr versteht. Doch spätestens in den 80er-Jahren wandelten sie Image und Mythos in bare Münze um: Aus der Band wurde nicht nur die größte der Welt, sondern auch ein millionenschweres und perfekt organisiertes Rock'n'Roll-Unternehmen, das bis heute Bestand hat. Unsere ME-Helden-Geschichte aus dem Jahr 2018, wegen des Todes von Charlie Watts am 24. August 2021 aktualisiert.


Ein einziges Mal fällt Mick Jagger aus der Rolle. Und die Filmkameras von Albert und David Maysles sind dabei. Ein paar Tage nach dem Konzert in Altamont am 6. Dezember 1969, eine Rennstrecke vor den Toren von San Francisco, ist Jagger in den Schneideraum der Brüder gekommen. Er will sich ihre Aufnahmen ansehen von seinem Auftritt, der die Fortsetzung der Hippieseligkeit von Woodstock werden sollte, aber dann als maliziöses Echo der Manson-Morde im August des Jahres in die Geschichte einging, der letzte Nagel in den Sarg der Love-and-Peace-Ära. Ein von Gewalt erfüllter Abend, bei dem die als Ordner engagierten Hells Angels das Publikum terrorisierten und den gegen die Willkür der Biker protestierenden Marty Balin von Jefferson Airplane auf der Bühne bewusstlos schlugen und an dessen traurigem Höhepunkt – die Stones haben vor 300.000 Menschen gerade „Under My Thumb“ angestimmt – der 18-jährige Schwarze Meredith Hunter, bis unter die Hutkrempe voll mit Aufputschmitteln, links vor der Bühne im allgemeinen Getümmel einen Revolver zieht und von dem Hells Angel Alan Passaro attackiert und mit fünf Stichen seines Messers getötet wird. Jetzt lässt sich Mick Jagger von David Maysles zeigen, was geschehen ist. „Konntest du sehen, was passiert ist“, wird er gefragt. „Nein, wir haben nichts gesehen, es war nur eines von vielen Handgemenge vor der Bühne“. Dann sieht er den Mord. „Oh, stimmt, da ist es. Wow. Wie schrecklich.“ Er verstummt. Alle Farbe weicht aus seinem Gesicht.
Dandy und Schlangenbeschwörer
Jetzt, in diesem kurzen Moment, ist er nicht der Verführer, der Showman, der Dandy, der Bürgerschreck, der Bad Boy, der Schlangenbeschwörer, der Salonlöwe, der Luzifer, der Superstar, der Sänger der Rolling Stones. Er ist ein kleiner Junge, betroffen und hilflos, bestürzt über die Geister, die er gerufen hat. Rape, murder, it’s just a shot away – Vergewaltigung, Mord, nur einen Schuss entfernt. Noch einmal soll ihm das nicht passieren. Wird es auch nicht. Der herbeigesehnten Revolution der Gegenkultur, deren Galionsfigur die Stones sind, hatte er schon im Jahr davor eine Absage erteilt, als er in „Street Fighting Man“ sang, dass einem armen Jungen nichts anderes übrig bliebe, als in einer Rock’n’Roll-Band zu singen. Sollte tatsächlich noch eine Spur von Idealismus in Jagger gewesen sein, wird er in diesem Augenblick ausgelöscht. Jetzt will er nur noch Ruhm und Ehre für die Stones. Er leitet in diesem Moment – die wirklichen Großtaten der Band liegen noch vor ihm – den Untergang des Rock’n’Roll ein, sein langsames Sterben, an dessen Speerspitze wie schon bei seinem Triumphzug in den Sechzigern immer die Gruppe stehen wird, die besinnungslosen Kommerz in „Satisfaction“ verlacht hatte und ihn künftig zu umarmen, wie es nur wahre Hedonisten können. Der Anfang vom Ende, er beginnt hier. Er macht die Stones, bislang arm wie Kirchenmäuse zu den reichsten Männern im Geschäft. Keine Marke verkauft sich besser. Und sie strecken einem die Zunge raus.
Ladies and gentlemen, the greatest rock’n’roll band in the world, the Rolling Stones. Bringen wir das doch gleich einmal hinter uns, damit es hinterher nicht heißt, keiner hätte es gesagt. Ohne die Stones wäre keiner von uns hier. Sie haben die Rockmusik in die Welt gebracht. Sie haben der Musik Gefahr gegeben, das Verruchte und Verbotene, das sexuell Aufgeladene. Sie haben definiert, was wir uns heute unter einer Rockband vorstellen. Charismatischer Sänger, lässige Gitarristen, solide Rhythmusgruppe, große Show, noch größere Sprüche. Die Stones erfinden das Vokabular, das uns heute so selbstverständlich ist, dass es im Lauf der Jahrzehnte so selbstverständlich wurde, dass es seine Bedeutung verloren hat. Heute, wo wir den Deckel drauf tun auf die Rockmusik, eine überholte Form, die nichts mehr aussagt, nichts mehr bedeutet, nichts mehr bringt, nichts mehr gibt, außer ein paar Stadien vollzumachen für Familienfeiern, bei denen auch Wurst verkauft werden könnte (und verkauft wird). Bis die nächste Generation von Kids entdeckt, wie klasse es ist, zu viert mit ein paar Gitarren im Keller zu lärmen, vermutlich. Warten wir’s ab.
Die Beatles waren die Nummer eins, immer. Aber sie waren Pop, Langhaarige vielleicht, aber eben doch genuin nette Typen. Nicht ungewaschen und schmuddelig wie die Konkurrenz aus London, die vielleicht nie aus dem Arsch gekommen wäre, wenn ihnen Lennon und McCartney nicht mit „I Wanna Be Your Man“ in einer Zehnminutenpause den ersten Hit geschrieben hätten. Die Stones nutzen ihre Chance. Sie sind der Gegenentwurf, sie sind Rock. Jagger, Keith Richards und Brian Jones sind zwar keine Arbeiterklassekinder wie John und Paul. Aber womöglich machte sie das so unberechenbar, dass man sie sich genau deshalb unmöglich als Schwiegersöhne vorstellen konnte. Sie waren vorlaute Scheißer aus okayen Familienverhältnissen, besuchten die Kunstschule und mussten einem allein deshalb suspekt vorkommen. Ihre Haare waren immer etwas länger als die der anderen, zu einer Zeit, als das noch Schlagzeilen in den Gazetten wert war und Empörung auf den Straßen. Es gefiel ihnen, dem Bürgertum mit demonstrativ hochgezogener Oberlippe ihre Verachtung zu zeigen, bevor Sid Vicious diese Geste zur Karikatur werden ließ. In einem Umfragebogen anno 1964 antwortet Brian Jones, damals noch de facto Anführer der Band und sowieso bestaussehendes Gruppenmitglied, bevor Drogen und Exzesse tiefe Furchen in sein Engelsgesicht schnitten und schließlich an den Grund eines Swimmingpools sinken ließen, auf die Frage nach seiner größten Karriereleistung, das sei der Bruch mit seinen Eltern gewesen.
Alles eine Frage der Perspektive
Als „ledergekleidete Transvestiten, faschistische Kinderschrecks und ausschweifende Hedonisten“ wurden die Stones in dem Bildband „Rock Dreams“ beschrieben – Jungs, auf deren Wolke Platz für niemand sonst ist als für sie. Jean-Luc Godard sah in ihnen den „Beginn einer Revolution“, und die Haute volée fand die androgynen Rüpel schnucklig und hatte Spaß daran, sie sich als das angesagteste Spielzeug der Zeit in ihre Paläste und Salons zu holen, zu einer Zeit, in der Jagger und Richards ihren Kumpel Brian Jones aufs Abstellgleis schoben und sich vom zweiteffektivsten Songwriterteam des Pop/Rock/Whatever zu den Glimmer Twins gewandelt hatten, wie sie sich selber mit der ihnen innewohnenden Bescheidenheit nannten – die Stan und Ollie des Rock, die ihre Rollen bis zur Perfektion spielten: Der Macher und Anschaffer Jagger auf der einen Seite, immer busy und emsig und wuselig und in Bewegung, immer dabei, sich selbst sein bester Pimp und seine beste Nutte zu sein, König der Masken und des Schauspiels, bevor David Bowie das Wort „bisexuell“ erstmals gehört hatte. Bianca Jagger heiratete er in einer denkwürdigen Zeremonie in Saint Tropez 1971 auch nur deshalb, weil sie fast genau so aussah wie er und dieser narzisstischste aller Pfauen des Rockgeschäfts fortan nicht mehr in den Spiegel schauen musste, um sich an sich selbst zu ergötzen. „Jeder, der mal ein bisschen Zeit mit Jagger verbracht hat, weiß, was für ein Haufen interessanter Jungs er sein kann“, lästerte Nick Kent, damaliger Starautor des NME. Der selbstvergessene Richards auf der anderen Seite, Inbegriff der Coolness und Kaputtheit, „Keef“, der Millionen von Jungs beibrachte, dass es für einen Gitarristen nicht darauf ankommt, was man spielt, sondern was man nicht spielt, und der sein Leben genau nach dieser Maßgabe führte, bis der Tanz mit dem Tod – „Dancing With Mr. D“, wie Jagger es auf GOATS HEAD SOUP nannte – Ende der Siebziger sogar diesem ewigen Überlebenden zahlloser Überdosen etwas zu intensiv wurde. Einen Moment der Blöße wie Jagger beim Anblick der Altamont-Filmaufnahmen hätte es bei ihm nie gegeben.
Es sei doch im Grunde eine ganz gut organisierte Angelegenheit gewesen, ein insgesamt recht gutes Konzert, hatte er einmal achselzuckend erklärt. Alles immer eine Frage der Perspektive. Mick Jaggers Langzeitfreundin Marianne Faithful, der sich Jagger einst vorgestellt hatte, indem er ihr auf einer Party Schampus übers Kleid kippte, um danach ihre Brüste mit nackten Händen trocken zu rubbeln, befand in den Siebzigern: „Wenn man als Schulmädchen Shelley und Byron gelesen hat, raubt einem Keith den Atem. Er ist das Sinnbild verdammter Jugend, auch wenn er mich mehr und mehr an Graf Dracula erinnert.“ Und wenn es gemein scheint, den großartigen Charlie Watts und Bill Wyman bis jetzt noch mit keiner Silbe erwähnt zu haben, beachte man, was Gründungsmitglied Ian Stewart über die Bedeutung der beiden Stars der Band sagte: „Wenn Brian, Bill, Charlie und ich nie das Licht dieser Erde erblickt hätten, hätten Mick und Keith dennoch eine Gruppe aufgemacht, die genauso wie die Rolling Stones ausgesehen und geklungen hätte.“
Sucking in the Seventies. So hatten die Rolling Stones höhnisch eine Compilation genannt, mit der sie sich 1981 von einem turbulenten Jahrzehnt verabschiedeten, das sich als zweischneidiges Schwert erwiesen hatte: Sie feierten ihre größten Triumphe, waren die beste Liveshow weit und breit und polierten ihren eigenen Mythos auf Hochglanz, wären aber auch beinahe in die Knie gezwungen worden, 1977, als Keith Richards in Kanada einen Prozess wegen Besitzes von Heroin erwartete, der ihn lebenslänglich hinter Gitter hätte bringen können. Schlimmer noch: Nach Millionen verkaufter Platten, einem Dutzend Nummer-eins-Hits, ausverkaufter Tourneen und fünf klassischen Alben in Folge, jedes für sich ein Meisterwerk – der beste Run, den jemals eine Rockband hatte –, waren die Stones am Ende des Jahrzehnts de facto pleite. Die rigiden Steuergesetze in Großbritannien, der teure Rechtsstreit und nicht zuletzt der maßlose Lebensstil Seite an Seite der wirklich Schönen und richtig Reichen, die das zur Genüge hatten, was den Stones abging, nämlich Geld, hatte seinen Tribut gefordert: Die bekanntesten Rockstars der Welt gingen auf die Vierzig zu und lebten auf Pump.
Wie viel Heroin verträgt der Mensch?
Was ihnen vermutlich sogar egal war. Wenn man erst einmal realisiert, dass man „Exile on Main St“, ihr Magnus opus aus dem Jahr 1972, aufgenommen unter widrigen bis unmenschlichen Umständen im modrigen Keller der Villa Nelcôte in Villefranche-sur-Mer gleich neben Nizza, die Keith Richards mit Family und Entourage bezogen hatte, um dort zu testen, wie viel Heroin ein menschlicher Organismus verkraften kann, bis er die Notbremse zieht, während die Kinder am Strand spielten, auch dann mehr toppen kann, wenn man sich anstrengt, der sieht es alsbald nicht mehr ein, sich auch nur ein bisschen anzustrengen. Ausgehend von „Goat’s Head Soup“ von 1973, beginnt die bis heute andauernde Phase der Erbverwaltung und Markenpflege, ab „It’s Only Rock’n’Roll“ im Jahr darauf sind sie sich auch für Selbstparodie nicht mehr zu schade: Fortan sind die Stones nie wieder etwas anderes als die Stones. Mal etwas besser, mal ziemlich viel schlechter, aber immer die Stones.
Was nicht heißt, dass sie nicht immer noch zu Großtaten fähig gewesen wären. „Goat’s Head Soup“ mag Nick Kent bei Erscheinen als „unaufregend“ beschrieben haben. Da wusste er aber noch nicht, was Fans ab Mitte der Achtziger an uninspiriertem Krempel erwarten würde, Ausschussware, für die sich selbst Stones-Tribute-Bands zu schade gewesen wären. Tatsächlich ist es ein verdammt gutes Album. Aber es ist nicht „Exile on Main St.“ . Oder „Sticky Fingers“. Oder „Let It Bleed“ und „Beggars’ Banquet“, als die Stones die Welt noch an den Eiern hatten und erklärten, dass alle Cops Kriminelle seien und alle Sünder Heilige. Selbst souveräne Würfe wie „Some Girls“ und „Tattoo You“ oder das unterschätzte, in München aufgenommene „Black & Blue“ können nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwar der Motor verdammt gut geölt war und immer noch wunderbar röhrte, wenn man aufs Gaspedal drückt, der Fahrer aber lieber immer wieder die selbe Strecke fuhr, anstatt mal eine Abzweigung zu nehmen und sich überraschen zu lassen, was es alles zu entdecken gibt. „Wir haben’s nach ,Exile’ immer wieder noch mal versucht, aber ich denke nicht, dass die Resultate danach wirklich der Rede wert waren“, merkte Jagger selbst einmal an, um sich danach wieder dem Geldzählen zu widmen.
Kohle im Rücken
Really sucking in the Eighties – and beyond. Wenn es einen entscheidenden Knackpunkt gibt, einen Point of no return, von dem sich weder die Stones noch die Rockmusik jemals wieder erholt haben, dann ist es die Stadiontour im Jahr 1981/1982, ein durch und durch perfekt durchorganisierter Rock’n’Roll-Karneval, für den selbst in Deutschland Hallen nicht mehr groß genug waren. Erstmals spielte eine Rock’n’Roll-Band eine Tour auch hierzulande in Fußballstadien. Entscheidend war, dass Keith Richards 1978 endlich Heroin gekickt hatte und kein Unsicherheitsfaktor mehr war. Vor allem aber hatte Mick Jagger de facto das Management übernommen, er zog die Fäden, er traf die geschäftlichen Entscheidungen. Er wusste, dass jetzt, im neuen Jahrzehnt, die Chance gekommen war, das Image und den Mythos der Stones in bare Münze zu verwandeln: Mit fast 40 Jahren beschloss er, aus seiner Band eine Organisation zu machen, nichts mehr dem Zufall zu überlassen. Im Jahrzehnt des Turbokapitalismus hängten die Stones an ihr Zungenlogo noch ein ™ dran und drängten auf Professionalisierung. Man sah durchtrainierten, im Fitnessstudio auf Vordermann gebrachten, edel eingekleideten älteren Herren dabei zu, wie sie in alten Lieder von jugendlichem Furor und sexueller Frustration sangen, ohne selbst noch daran zu glauben. Dafür spielten die Stones sauber und tight, jeden Abend aufs Neue. Nicht einfach nur die Spielregeln änderten sich. Es war ab jetzt ein komplett neues Spiel. 50 Millionen Dollar Gewinn können sich nicht irren. Der Rolling Stone ätzte: „Danach finden wir Mick Jagger enthüllt als meisterlichen Karrierestrategen, als den zähesten und scharfsinnigsten Geschäftsmann, der nach Bob Hope und Frank Sinatra die Entertainmentszene betrat.“ Es mag zwar immer lähmend sein, alt zu werden, wie Jagger schon 1966 in „Mother’s Little Helper“ festgestellt hatte. Aber wenn es einen selbst betrifft und man ein bisschen Kohle im Rücken hat, lässt es sich dann schon aushalten, sofern man nicht beim Kokosnusspflücken von der Palme fällt und danach monatelang pausieren muss. Dass die Stones fortan nichts mehr mit dem zu tun hatten, was es früher einmal geheißen hatte, in einer Rockband zu spielen, ist konsequent.
Arme Jungs, wie in „Street Fighting Man“ besungen, waren sie ja ohnehin nie gewesen. Mick Jagger und Keith Richards haben seither immer wieder das Tischtuch durchschnitten. Sofern man es beurteilen kann, können sie einander seit Mitte der Achtzigerjahre nicht mehr ausstehen. Und finden einfach nur deshalb wieder alle Jubeljahre zusammen, weil sie es ohne Rolling Stones nicht aushalten können und gerne gutes Geld verdienen. Bassist Bill Wyman ist schon vor einem Vierteljahrhundert ausgestiegen und seither nicht mehr ebenbürtig ersetzt worden. Charlie Watts spielt weiter stoisch die Drums, wie er es als tatsächlich coolster und bestgekleideter Stone immer schon getan hat. Ron Wood, den Keith Richards Mitte der Siebzigerjahre von den Faces in die Band geholt hatte, weil er den überragenden Mick Taylor mit einem Gitarristen ersetzen wollte, der ihn auf der Bühne nicht schlecht aussehen lassen kann, hat erst in den letzten Jahren eine Leitrolle eingenommen, seitdem „Keef“ zunehmend erratisch bei Konzerten agiert. Es hat etwas Tröstliches, dass der Zahn der Zeit nicht einmal vor ihm Halt macht, dem man nachsagt, nach einem Atomkrieg gebe es noch die Kakerlake und ihn. Wie es auch erfreulich ist, dass diese alten Herren immer noch in der Lage sind, einen glücklich zu machen, wenngleich es sich nicht um musikalische Großtaten handelt. Als George W. Bush während seiner Amtszeit bei den Stones anfragte, ob er für einen Treff der Regierungsmitglieder der Welt eine Etage in einem Nobelhotel übernehmen könne, die die Band bereits angemietet hatte, ließen ihn Jagger und Co. wissen: „You can’t always get what you want.“ Irgendwo auf der Welt sang ein Bach-Chor dazu. Und vielleicht sah Mick Jagger ganz kurz wieder aus wie ein kleiner Junge, wie damals Ende 1969, damals als die Stones wirklich die größte Rockband der Welt waren und es ihrem Publikum noch nicht nachspielen mussten. Aber nur vielleicht.
Diese ME-Helden-Geschichte Nr. 84 ist zuerst im Musikexpress 07/2018 erschienen.