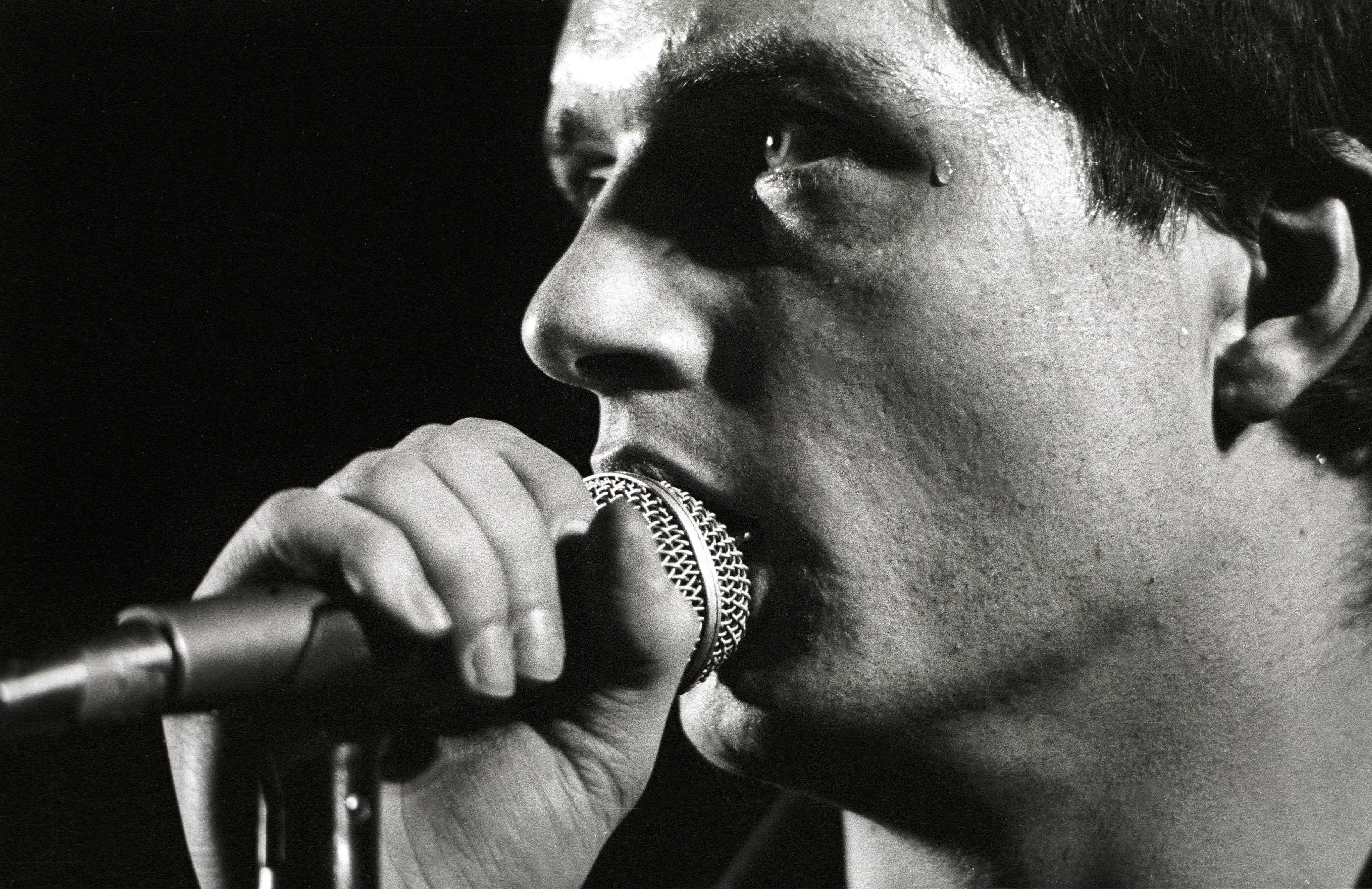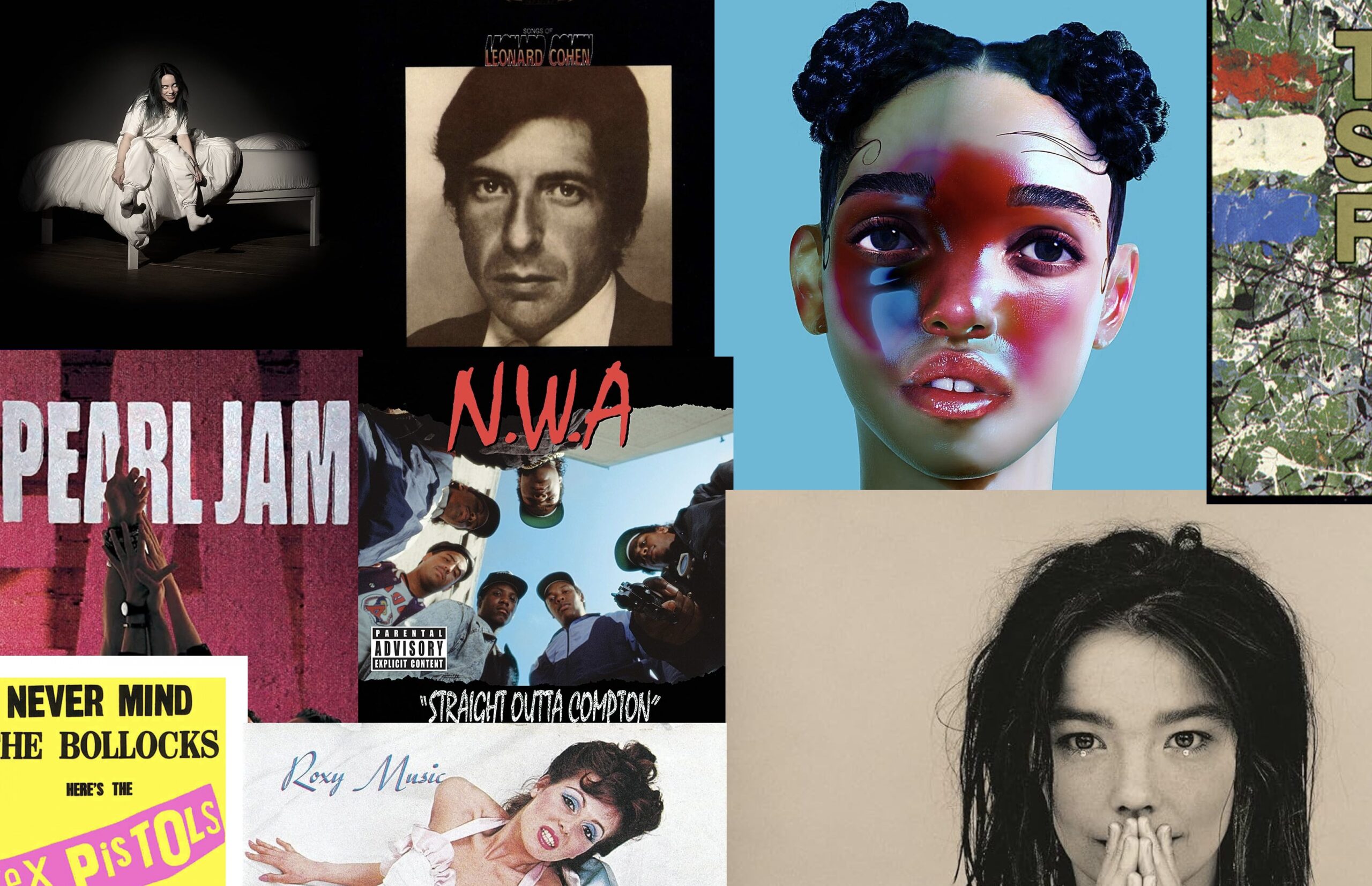Paulas Popwoche: Dokustand Deutschland
Irgendwas ist weird im Staate. Die Dokus rund um Popthemen regnen auf uns herab - und wir können nichts anderes tun, als sie uns reinzutun und unsere Gemüter erregen zu lassen
Und, warum?
In einer Doku namens „Der Star-Anwalt: Christian Schertz und die Medien” durfte STARANWALT CHRISTIAN SCHERTZ sich unlängst in einer ARD-Doku darstellen – oder eher bewerben. In der männerlastigen Doku gibt es wenig Kritik an einem, der zum Beispiel Till Lindemann nicht einfach nur vertritt: „Ich vertrete ja nur seine Rechte!” –, er bewertet natürlich auch moralisch, stellt sich natürlich auf die Seite eines Mannes, der sehr junge Fans mindestens bedrängt (und nach Aussagen einiger Frauen auch missbraucht, jaja, mutmaßlich mutmaßlich mutmaßlich – slide mir ja nicht in meinen Briefkasten, Vadder Schertz!) und warnt vor zu viel Prüderie. Dazu sprechen dann noch weitere Männer über den Typen, es ist ganz kultig, schließlich muss Benjamin von Stuckrad-Barre auch noch was über seinen guten Freund sagen. Ihr denkt, es kann nicht schlimmer werden? Doch, dann schwadroniert sich Schertziauch noch herbei, #metoo nach Deutschland gebracht zu haben, weil er Betroffene von Regisseur Dieter Wedel vertreten habe, als wäre es nicht the bare minimum. Denn das können solche Typen natürlich auch noch, sich wappnen in jede Richtung und sich den Täterschützer-Schuh nicht anziehen, indem sie selbst bestimmen, wann es echte und wann es unechte Opfer gibt.
In einer Welt voller Schertzes, sei ein Kavka. In der x-ten Aufbereitung der (bekannten) Rammstein-Vorfälle, diesmal mal wieder als Podcast, diesmal unter dem Titel „Rammstein – Row Zero”, kommt in der vierten Folge kommt Markus Kavka zu Wort und sagt einige schlaue Sachen über Fantum und Misogynie. Sonst erfährt man nicht viel Neues, weil sich nur an den bekannten Fakten entlanghangelt und sie aufgeblasen wurden.
Lindemann wird auf dem Titelbild wie ein Filmheld inszeniert. Bei noch einem (!) Podcast, der dieser Tage erschien, ist es noch schlimmer, da gibt es dazu noch coole Flammen. Er heißt dementsprechend auch “FEUERZONE”.
Nun bin ich die Letzte, die sagen oder schreiben würde, es sei jetzt mal gut mit „dem Thema”. Die Frage ist nur, was das Thema ist. Shelby Lynn und die anderen (anonymen) jungen Frauen müssen zum gefühlt hundertsten Mal ihre traumatischen Erlebnisse schildern, weil wir es in der Debatte um sexuelle Gewalt immer wieder verpassen, den Transfer von einzelnen Tätern zu systematischen Problemen und gesamtgesellschaftlichen Verhalten gegenüber Betroffenen zu machen – und unser Verhalten zu Sexualität und Macht auszuloten.
Wenn wir immer nur Einzelne zu Monstern machen (wie es auch bei Weinstein schon passierte), die man überhöht, als wären sie eben nicht ganz normale Männer mit Macht, an denen man sich abarbeitet und anhand derer man sich im Vergleich immer „nicht so schlimm” finden kann, kommen wir nicht weiter.
Die Beiträge zu Rammstein bleiben oft unpolitisch und sind nur voyeuristisch – und bringen daher nicht viel. Viel mehr sollten wir schauen, wo diese „Row Zeros” noch überall bestehen, welche Mittäterschaften es da gibt – im direkten Umfeld, aber auch strukturell, wo unser eigenes Fehlverhalten liegt, wenn wir weggucken und Machtausübungen in der Sexualität normalisieren – ja, auch in Pornos, in unseren eigenen Beziehungen, und bei denen, die wir anhimmeln und zu noch mehr Macht verhelfen. Das heißt, es muss über juristische Fragen hinausgehen (oder wir müssen hier und da Gesetze ändern). Die Ohnmacht, die entsteht, weil wir vor so vielen offenen Fragen stehen, führt dazu, dass Menschen, die erschüttert von dem Verhalten der vermeintlichen Monster sind, sich auch den 20. Podcast zu Rammstein reinziehen werden – und fertig ist der full circle. Es werden Arschlöcher zu Superstars gemacht, dann finden alle raus, dass es sich um Arschlöcher handelt, die einen findens okay und machen so weiter wie bisher, für die anderen wird diese Erkenntnis dann auch wieder zum Kulturprodukt, gern auch besonders hip, True-Crime-mäßig und spannend. Dafür werden diese Betroffenen wieder und wieder instrumentalisiert. Am Ende gewinnen immer diese Typen und ihr System, weil nichts führt da raus, wenn wir nicht das große Ganze in Frage stellen wollen.
Nur für den Kick
(Fast) ganz anderes Thema: Die Doku über die Hamburger Schule. Meine Facebook-Timeline – denn da leben die HS-Veteran*innen und ich auch – war voll mit Diskussionen (und Witzen) dazu. „Die Hamburger Schule – Musikszene zwischen Pop und Politik” von Natascha Geier umfasst zwei mal je eine halbe Stunde, die vor allem Männeregos explodieren lassen haben, weil naturgemäß nicht alle drin vorkommen konnten. Das schien mir auch gar nicht der Anspruch gewesen zu sein, es gibt ja zu kulturellen Epochen immer tausend Dokus und Reportagen und jede*r Macher*in fängt halt einen oder mehrere Aspekte ein – Geier hat sich vor allem an ihre eigene Zeit erinnert und Wegbegleiter*innen interviewt. Übrigens ein Ansatz, den männliche Pop-Autoren auch ganz oft wählen – Frauen müssen aber immer ganz besonders abliefern und beweisen, dass sie qualifiziert sind, eine Geschichte zu erzählen – ups, jetzt hab ich ein Frau-Mann-Ding daraus gemacht, obwohl Bernd Begemann gesagt hat, dass das damit gar nichts zu tun hat.
Natürlich nicht! Es ist wahrscheinlich Zufall, dass in den meisten Bands keine einzige Frau mitgespielt hat und auch Zufall, dass super viele Protagonisten von damals auch heute noch an jungen Frauen rumbaggern, wie man so hört. Aber immerhin ist man ja nicht so schlimm wie Rammstein, richtig?
In diesem Blogbeitrag wurde das ganze Facebook-Theater übrigens noch mal für alle, die ein Leben da draußen in der wirklichen Welt haben, aufbereitet:
Für den Augenblick
Alles, was in den oben genannten Dokus schlecht oder mittel läuft, ist hier gut: „Millennial Punk – Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung” (von Diana Ringelsiep und Felix Bundschuh) (Linus hat in der vergangenen Woche schon darüber berichtet) ist so unterhaltsam, so wholesome, so mutig, so lustig, so liebevoll – und vor allem so politisch wie es sein sollte. Es kommen viele verschiedene Leute aus allen möglichen Szenen zu Wort, es gibt kein komisches Gatekeeping, es wird nicht mal vor Mainstream-Pop-Punk Halt gemacht. Es wurde geschafft, wirklich alles, was in den Nullern mit Punk zu tun hatte, einzufangen und abzubilden – von der BRAVO bis zum provinziellsten AZ. Damit ist die Doku auch was für Menschen, die es in keine, teilweise elitären Szenen „geschafft” haben – sondern als Teenie alleine vor VIVA hockten und sich irgendwie „anders” fühlten. Die Doku bleibt dabei nicht bei Anekdoten, Romantisierung, Verkultung, Szenestreitigkeiten oder Oberflächlichkeiten, sondern legt den Fokus auf die Verbindungen zu Antifaschismus, Feminismus, Seenotrettung, Ausbeutung und so weiter und sofort. On top gibt es auch noch Selbstkritik und Offenheit gegenüber anderen Szenen und Einflüssen. Ich kann’s kaum glauben, ich bin verliebt in eine Doku!