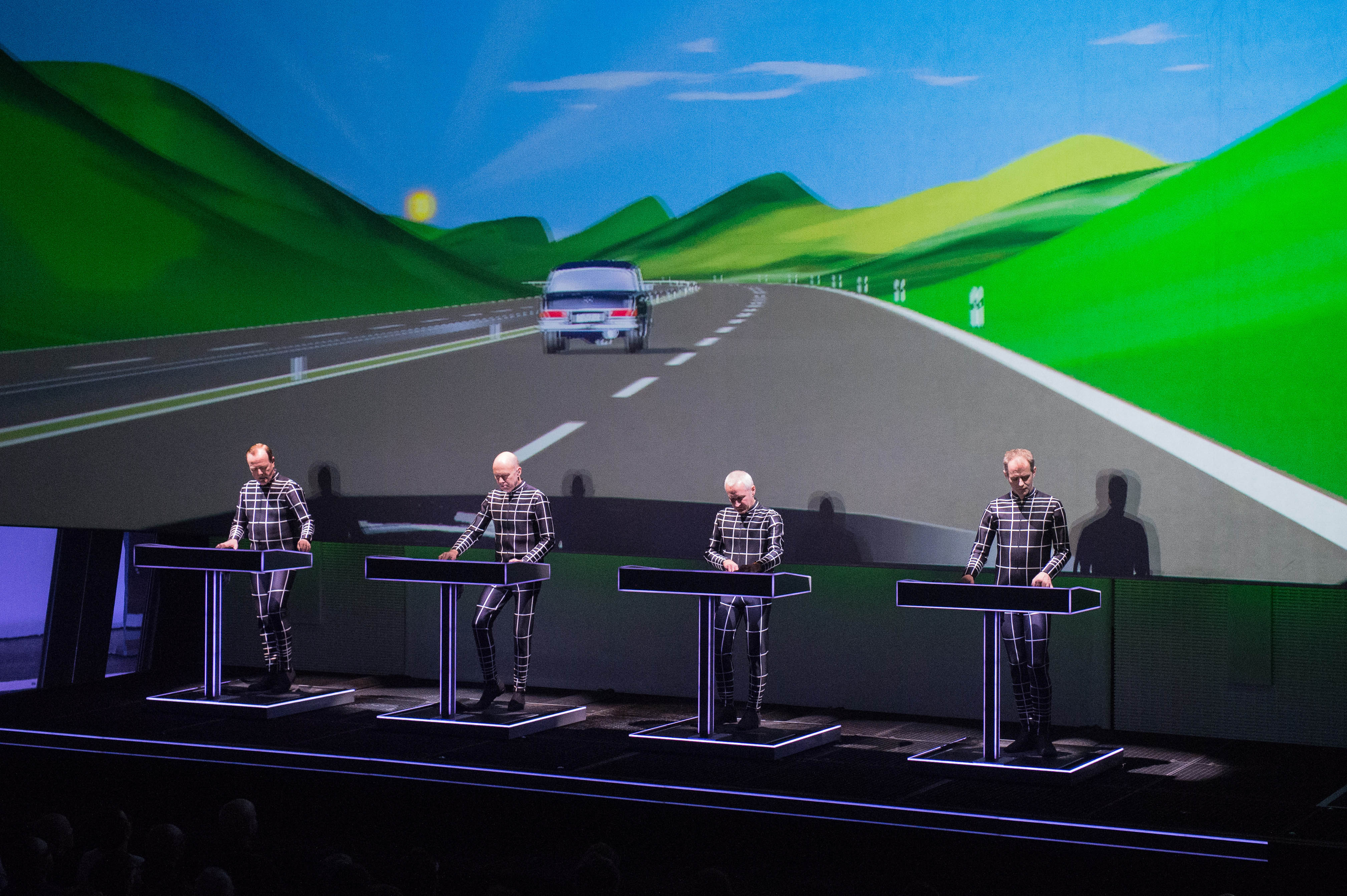Robbie Williams: Wirklich kein Profi
Wer in Robbie Williams Abgründe schaut, ist ihm vermutlich schon verfallen.
Jeder Ort kann seine Bühne sein. Und wenn er dort oben steht, geht es um nicht weniger als sein Leben. Robbie Williams Superstar – für ihn schien das schon ausgemachte Sache zu sein, als er noch den Klassenkasper gab, um Lehrern aus- und an Mädchen heranzukommen, die sich mit kalkulierten Peinlichkeiten, unverschämtem Charme und gnadenloser Offenheit erobern ließen. Das war nicht die Minderheit (seine erste „große Liebe“ Lisa Parks allerdings ließ sich von seinem Rap-Gehampel nicht beeindrucken). Robert Peter Williams galt andererseits als schüchterner Junge, der Selbstzweifel mit sich selbst ausmachte. Als ihm Take-That-Manager Nigel Martin-Smith 1990 den Künstlernamen Robbie verpasste, war sein Fluchtpunkt quasi amtlich. Doch Robbie, der Tausendsassa, muss bis heute kämpfen, gegen Paranoia, Sucht, die Widersprüche Robs, um seinem Publikum zu bieten, was er von sich selbst erwartet: dralles, formvollendetes Entertainment, das in seinen besten Momenten in ironischen Brüchen, arrogantem Größenwahn und tiefer Emotionalität immer wieder einen Blick auf Robert zu- und durchlässt. Nein, Robbie Williams ist alles andere als ein professioneller Entertainer. Kein Profi würde so viel riskieren, beständig weit entfernt von dem, was man „Routine“ nennt. Sein Publikum weiß das und fühlt es. Und bekommt es auch zu spüren, wenn sein Star beispielsweise eine komplette Show in den Schnee setzt. Weil er Mittelmaß nicht kennt, weil es für Williams Routine nicht gibt. Auch nicht in seinen Texten, einerseits voller vermeintlicher Klischees einer zur Depression neigenden Persönlichkeit, die unter echten Herzschmerzen freilich nicht allzu phantasievoll mit dem Schicksal hadert. Doch immer wieder wird er konkret genug, um mit seiner Rache jene zu treffen, die ihm diese Schmerzen zugefügt haben: Lehrer, Manager, Liebhaberinnen. Ähnlich wie bei Eminem fällt auf, dass er, obwohl er seine Person, auch öffentlich, in Frage stellt, in seinen Texten in der Opferrolle aufgeht. Robbie schrieb solch selbstgerechte Gedichte schon zu Take-That-Zeiten – um sich damit selbst aufzurichten. Eine im Mainstream absolut ungewöhnliche Qualität; mehr Wahrhaftigkeit, als die Unterhaltungsbranche gemeinhin duldet, aber auch eine satte Portion „Escapology“, ein ungeheuerliches Charisma und eine Bühnenpräsenz, von der das ganze „DSDS“-Starterfeld nur träumen kann, genügten, um ihm viel durchgehen zu lassen. Zum Beispiel die Anmaßung SWING WHEN YOU´RE WINNING, seine Interpretation der Klassiker des so brillanten wie abgründigen „Rat Pack“ um Frank Sinatra, das Williams nicht von ungefähr verehrt. Dort will er hin, dort ist er vielleicht in gewisser Hinsicht schon angekommen. Doch mit Coversongs und verwegenem Entertainment allein beherrscht niemand die Hitparaden auf Dauer. Robbie braucht einen kongenialen Partner wie Guy Chambers. Der öffnete ihm mit der Ballade „Angels“ die Himmelstür und hielt noch manchen goldenen Schlüssel mehr am Bund. Was für diese Nummer im Speziellen gilt (Robbie selbst stahl ein wesentliches Stück von einem irischen Musiker, mit dem er in Dublin abstürzte), brachte das Komponisten-Duo zur Meisterschaft: Sie klauten und klaubten aus der Popgeschichte große Momente zusammen und fügten sie zu Hits, denen keiner entgeht. Kein Grund zur Anklage: das ist Pop as Pop can. Dass es ihm bislang dennoch nicht gelang, die USA zu erobern, liegt auch daran, dass man es dort nicht sehr schätzt, seinen Stars zu tief in die inneren Abgründe zu schauen. Das wiederum könnte dafür sorgen, dass sich vor Robbie Williams neue Abgründe auftun. Er weiß das selbst am besten. Auf der sicheren Seite wird einer wie er wohl nie ankommen.