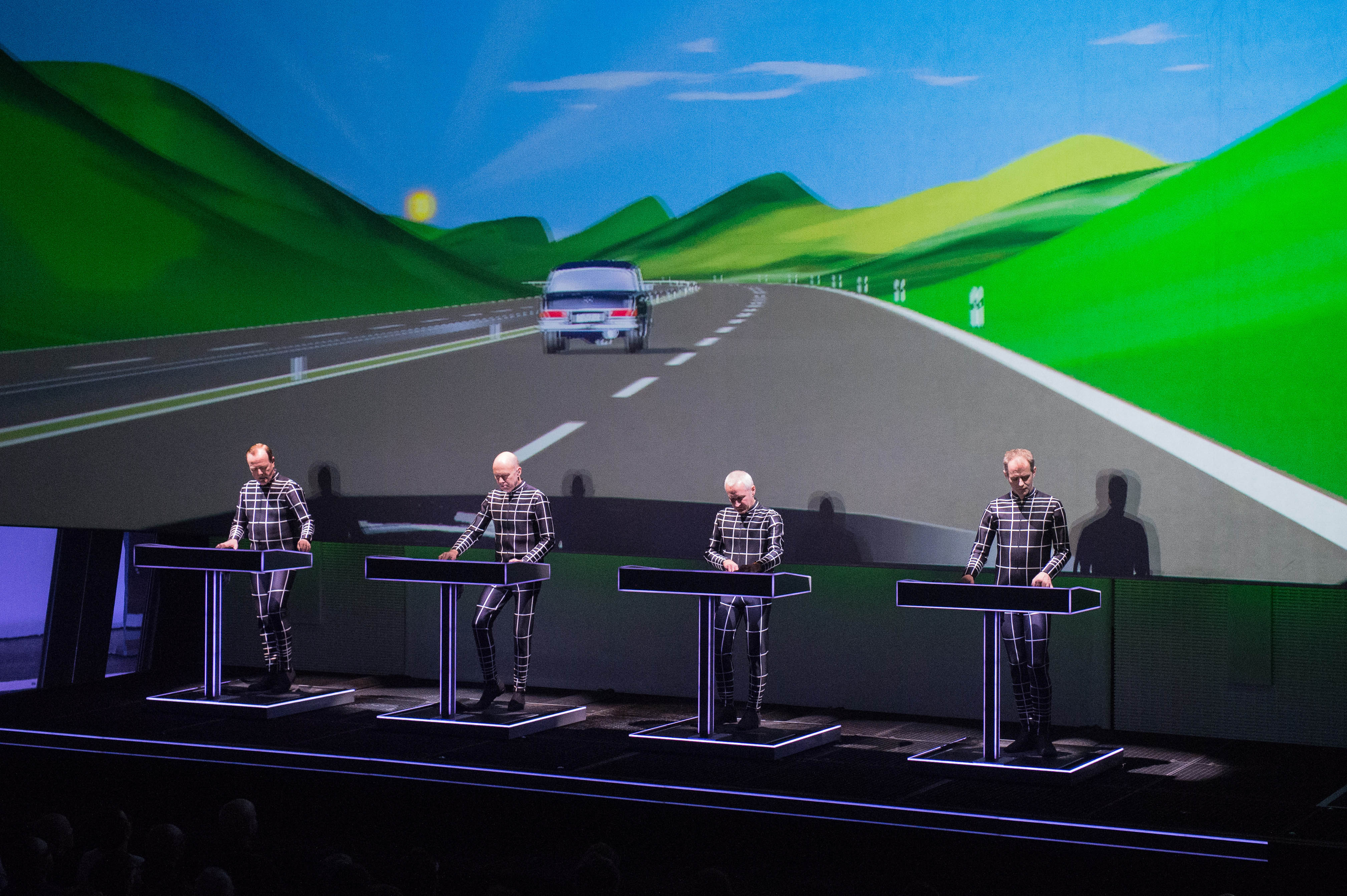Sophie
Oil Of Every Pearl’s Un-Insides
Transgressive/[PIAS] Coop/Rough Trade (15.06.)
Die Queen des Anything Goes zeigt Wege aus der Monotonie des Mainstreams in ein glorreiches Zeitalter des Avant-Pop.
So radikal ihre Single „It’s Okay To Cry“ und vor allem das dazugehörige Video im vergangenen Oktober waren, so schienen sie doch auch das Ende des Faszinosums Sophie einzuläuten. Nach Jahren des Verwirrspiels ihrer mit irdischen Sinnen nicht greifbaren Chaosmusik, nach Interviews hinter Masken und ausschließlich extrem manipulierten Gesangsaufnahmen zeigte sich die Transgenderfrau hier erstmals „in echt“. Oberkörperfrei und mit verhältnismäßig wenig Make-up präsentierte die als Schotte Geborene, jetzt in L.A. Ansässige sich minutenlang im One-Take-Clip sogar mit ihrer tatsächlichen, nur leicht modulierten Stimme. In ihrem Gefüge also: krass.
Doch so großartig diese Song gewordene Umarmung auch war, so war das Stück doch fast ernüchternd normal strukturiert. Ein Bruch in Sophies Werk, in dem alles, aber eben nicht Normalität die Norm ist. Sogar ein relativ, reeelativ traditioneller Popsong wie das hochschwurbelnde „Just Like We Never Said Goodbye“ auf ihrem ersten Longplayer, der 2015er-Zusammenstellung PRODUCT, wagte Wahnsinn wie den Beibehalt eines Räusperns inmitten all der Hyperkünstlichkeit (für Interessierte, bei 00:20 Min.) und vor allem: den Verzicht auf jegliche Drums. Unvorstellbar im Drop-zentrierten Pop, den Sophie von dann an mit Arbeiten für Madonna, Charli XCX, Vince Staples und Mø unterwandern sollte.
„It’s Okay To Cry“ wirkte wie ein Manifest, das Bekenntnis zum und der Durchbruch in den Mainstream. Freilich immer noch verrückt und entrückt genug, um nicht im Formatradio zu landen, vergleichbar etwa mit den ersten Momenten eines beginnenden Trips, in denen man zwar noch mit beiden Beinen im Leben steht, dieses Leben aber schon stetig mehr von quietschbunten Farbstrahlen durchblitzt wird. Der Entschluss zum Abschied von den vogelwilden Anfangstagen schien aber getroffen.
Diese Musik und diese Musikerin können alles sein was sie wollen
Doch bereits die Folgesingles, das donnernde „Ponyboy“ und der Industrial von „Faceshopping“ korrigierten diesen Eindruck. Da war sie wieder, die Haken um Haken schlagende Sophie, diese Königin des kreativen Exzesses, die ihre eigene Nachkommenschaft metzelt, um den noch zuckenden Überresten auf dem Schrottplatz des Pop mit Infusionen aus Säureblut von Außerirdischen ein neues, bizarres Leben zu schenken. Mit einer DNA aus grell überbetontem Bubblegum-Pop, unberechenbaren Querschüssen aus der Flinte Aphex Twins neben himmlischen Ambient-Sequenzen, irren Soul-Passagen und hämmernden Horror-Beats. Nie wieder soll sich Sophies Debütalbum nach der Leadsingle als Opener bekannt oder gar gewöhnlich anfühlen.
Dabei verfügt es über ein Ausmaß eigenständiger Eingängigkeit, wie man es in der Monotonie unserer wiederkäuenden Reboot-Kultur nicht mehr für möglich gehalten hätte. Der Banger „Immaterial“ erinnert mit seinen „Immaterial girls! Immaterial boys“-Schlachtrufen natürlich an das „Material Girl“ und ist die stärkste Empfehlung für die Nachfolge Madonnas. Aber so weit dürfte die Welt noch nicht sein. Sophie wird erst Popstar werden können, wenn sie im 22. Jahrhundert noch lebt – was wir nicht ausschließen wollen.
Bis zu ihrer Regentschaft soll sie uns die Wartezeit versüßen, indem sie vermehrt den amtierenden Chartsherrschern Ideen ihres Avant-Pop injiziert. Für die, die seit ein paar Zeilen Parallelen zu Lady Gaga ziehen: So verkehrt ist das nicht. Denn mit dieser Platte vollzieht Sophie zumindest inhaltlich einen Richtungswechsel wie wir ihn im Übergang von Gagas THE FAME-Phase zu BORN THIS WAY erlebt haben. Zu Ruhm gelangte Mother Monster mit brillantem Nonsens. Nachdem sie weltweite Aufmerksamkeit hatte, wurde sie politisch.
Bewerbung auf die Nachfolge Madonnas oder Lady Gagas

Noch 2017 nach der Kategorie ihrer Musik gefragt, antwortete Sophie: „Werbung“. Die Artworks ihrer frühen Singles zierten Objekte aus Plastik, Sinnbilder der Wegwerfkultur, herrliche Bedeutungslosigkeit. OIL… ist dagegen durchzogen von Parolen der Selbstermächtigung, untrennbar mit der Urheberin verbunden. Diese Musik und diese Musikerin können alles sein was sie wollen. „You could be me and I could be you“, heißt es in „Immaterial“ und weiter: „Without my legs or my hair, without my genes or my blood, with no name and with no type of story“.
OIL OF EVERY PEARL’S UN-SIDES ist ein unmöglicher Titel, der zu einem unmöglichen Album passt. Das ist letztlich gar kein Album as we know it, obwohl es mit dem „Hit“ beginnt und dem neunminütigen, stürmischen Epos „Whole New World/Pretend World“ endet. Hätten The Doors Of The 21st Century auch nur irgendeine Chance darauf gehabt, ihren Bandnamen umzusetzen, hätte so ihr Update von „The End“ klingen können. Das ist selbstverständlich Quatsch, aber, um eben noch im Bild zu bleiben, bevor auch dieses gleich wieder zerläuft: Dieses Album ist eben keins, sondern ein Blick durch die Tür zu einer fantastischen Welt, in der ganz andere Gesetze gelten. Vielleicht und hoffentlich sogar: gar keine. Eine Welt, die wir gar nicht erst versuchen sollten zu verstehen. Wir sollten uns ihr einfach hingeben und uns an ihr berauschen.