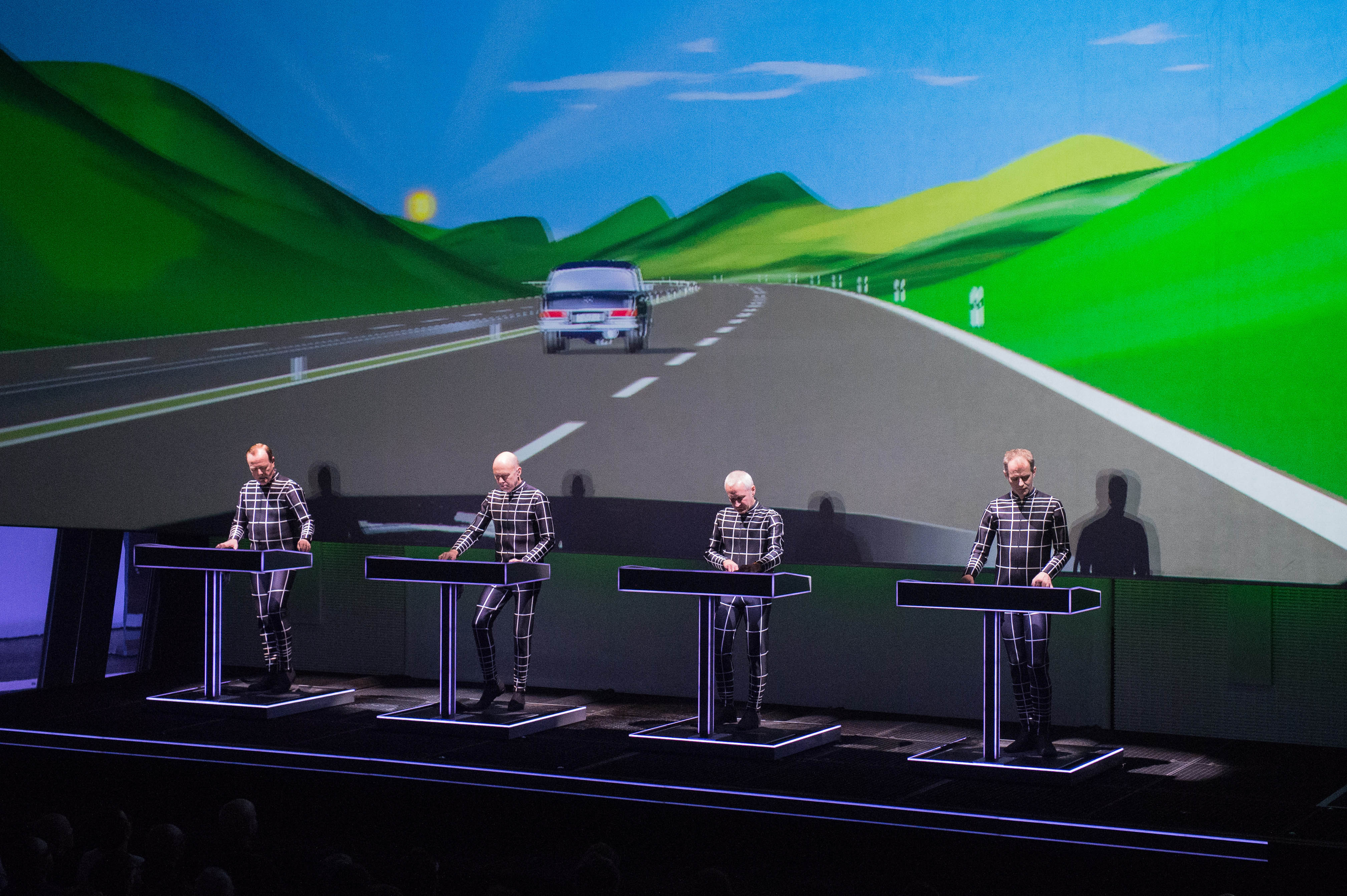Wes Anderson: Die Welt neben der Spur
Das Kino von Wes Anderson erinnert an ein Puppenhaus – mit akribisch gedrechseltem Interieur und voll wunderlicher Charaktere. Der Amerikaner bringt unsere Generation zum Lachen und zum Weinen wie kein anderer Regisseur der Gegenwart. Am 10. Mai startet sein neuer Film „Isle of Dogs“ in den Kinos.
Die Autorentheorie. Wisst ihr Bescheid. Geht zurück auf André Bazin und eine Gruppe junger französischer Filmkritiker, darunter François Truffaut und Jean-Luc Godard. Formuliert 1957 in den „Cahiers du Cinéma“, argumentiert sie, dass der Regisseur und nur der Regisseur die künstlerische Triebfeder eines Films ist. Auf diese Weise wollten die jungen Himmelsstürmer die Arbeit von geschätzten Filmemachern im Hollywood-Studiosystem aufwerten, die sie nicht als einfache Handwerker oder Angestellte ansahen, sondern als ernst zu nehmende Künstler mit unverkennbarer Handschrift und klar umrissenen Vorlieben und Themen. Unterstützt von amerikanischen Kritikern wie Andrew Sarris und ihrer eigenen Herangehensweise in den Filmen der Nouvelle Vague, hält sich die Theorie, oftmals angegriffen und angefeindet, auch mehr als 60 Jahre später noch wacker.
Immer wieder Trackingshots
Wenn wir von einem Film sprechen, identifizieren wir ihn automatisch als Werk des jeweiligen Regisseurs: „Ein Film von…“! Wes Anderson ist das beste Argument, das die Autorentheorie im Jahr 2018 haben könnte. Seine Filme entspringen unverkennbar ein und demselben Gehirn, tragen eine große Handschrift. Ein Blick auf eine einzige Einstellung reicht, um den Texaner als ihren Urheber zu identifizieren. Andersons Person ist untrennbar verbunden mit der Schöpfung von Figuren wie den Royal Tenenbaums, Max Fischer, Steve Zissou oder Herman Blume. Verdammt, sein eigener Geburtsname, Wesley Wales Anderson, klingt so literarisch und verquast und hochgestochen, als könne er eine Hauptrolle in einem seiner Filme spielen, die bevölkert sind von Figuren, die klingende Namen tragen wie Guggenheim oder Mapplethorpe, und sich ergehen in zahllosen Anspielungen auf andere Filme und Romane und Platten. Ein Spiegelsaal der Selbstreferenzialität, durch den sich die Kamera von Robert D. Yeoman – Andersons Kameramann in all seinen Spielfilmen, beginnend mit dessen Debüt „Bottle Rocket“ (den blöden deutschen Titel „Durchgeknallt“ ignorieren wir, wie auch den blöden deutschen Titel „Die Tiefseetaucher“ für „The Life Aquatic with Steve Zissou“, einverstanden?) im Jahr 1996 – in immer neuen Variationen des gleichen stoischen, flachen Trackingshots bewegt.

Überlegen wir uns einmal, wie Anderson diesen Wesley Wales Anderson in einem seiner Filme vorstellen würde. Vielleicht würde er ihn in extremer Slo-Mo aus einem Bus steigen lassen zu den Klängen eines verkauzten Stücks Chamber-Pop. Er würde eine seiner eleganten, aber immer etwas zu klein wirkenden Anzüge tragen und überhaupt picobello aussehen, mit einer Frisur, die er bei Owen Wilsons Figur Eli Cash in den „Tenenbaums“ geklaut haben könnte. Oder besser noch: bei dem von Wilsons Bruder Luke gespielten gefallenen Tennis-Champion Ritchie, der immer die gleichen Fila-Outfits aus der Björn-Borg-Collection unter seinem kamelhaarfarbenen Sakko trägt. Vielleicht würde man Wesley Wales Anderson zunächst einmal aus dem Off hören, wie er versucht, seinen Lehrer zu belehren, wie Jason Schwartzman als Max Fischer in „Rushmore“. Oder ein Schriftsteller könnte über ihn sprechen, bevor wir ihn zum ersten Mal sehen, wie Anderson seine Hauptfigur in „Grand Budapest Hotel“ vorstellt, den sagenumwobenen Concierge Gustave.
Er könnte in allerletzter Sekunde Bill Murray überholen beim Versuch, einen Zug zu erreichen, und in dem Moment, in dem er ihm, wieder in extremer Zeitlupe und mit langen, schlaksigen Beinen, den entscheidenden Meter abnimmt, beginnt ein Song der Kinks zu spielen, irgendeine ihrer leiernden B-Seiten, die nach Music Hall klingt und Vaudeville und aus der Zeit gefallen wirkt, weil sie nur sich selbst verpflichtet ist. Wie Adrien Brody in „Darjeeling Limited“, richtig? Oder man sieht ihn vielleicht auf einem Gemälde, umgeben von seiner Gang von Schauspielern, mit der er bevorzugt arbeitet? Als Figur in einem Theaterstück oder einer Aufführung im Puppentheater – Hauptsache, ein Vorhang kann sich vor dem Zuschauer öffnen? Oder ein Erzähler würde berichten in hochgestochenen, fein gedrechselten Sätzen von seiner Kindheit in Texas als Sohn eines Anzeigenmannes und einer Archäologin, als zweiter von drei Söhnen?
Eine Welt, die uns vertraut ist
Die Kamera würde an einem Querschnitt des Hauses der Magnificent Andersons vorbeifahren und uns erklären, in welchen Zimmern sich Anderson wann und warum aufhielt. Und natürlich, warum er ein Schlitzohr ist oder Halunke oder Haudrauf und warum er immer so traurig und melancholisch ist – und dass es einen handfesten Grund dafür gibt, warum er immer wieder Filme macht über Kinder, die von der Trennung ihrer Eltern erschüttert werden, als würde neben ihnen ein Meteor einschlagen. Wesley Wales Anderson wäre eine wunderbare Figur in einem Film von Wes Anderson. Nicht, weil er so gut hineinpassen würde, Seite an Seite mit den kuriosen Figuren, die sich in Andersons akribisch gedrechselten Drehbüchern tummeln. Sondern, weil diese Filme ein Teil von ihm sind: Sie spielen in der Welt, wie Wes Anderson sie sieht. Eine Welt, die auch die unsere ist, das Texas von „Bottle Rocket“, die St. John’s School in Houston von „Rushmore“, das New York von „The Royal Tenenbaums“, die Unterwasserwelt von „The Life Aquatic with Steve Zissou“, das Indien von „Darjeeling Limited“, die kleine Ostküsteninsel von „Moonrise Kingdom“, das Edelhotel in den Bergen in „Grand Budapest Hotel“. Eine Welt, die uns vertraut ist. Und doch leicht neben der Spur liegt, weil sie so nur im Kopf von Wes Anderson existiert. Und seinen Filmen. Wo alles immer perfekt aussieht. Wo jedes Detail zählt. Wo immer nur ausgesucht gute Musik spielt. Und in der Figuren Gefühle nachspielen wie Verzweiflung, Trauer und Verlangen, bis wir ihnen jedes Wort glauben, weil das die Magie des Kinos ist. Und lachen und weinen und sie gleich noch einmal sehen wollen, weil sie etwas in uns berührt haben, wie es in dieser Form die Filme von keinem anderen Filmemacher tun.
Wenn einer hinfällt und liegen bleibt, ist es eine Tragödie. Wenn einer hinfällt und wieder aufsteht, ist es eine Komödie. Hat Billy Wilder einmal gesagt. Heißt es. Und wenn es nicht Wilder war, ist es auch egal. Weil es trotzdem stimmt. Ohne Hinfallen keine Geschichte, alles andere ist Slapstick. Wes Andersons Filme sind Komödien. Seine Helden fallen hin. Sie bleiben oftmals liegen. Und dann stehen sie doch wieder auf. Man erinnert sich an die Filme nicht, weil man sich ausgeschüttet hätte vor Lachen. Man erinnert sich an sie, weil sie so traurig sind, dass man Weinen müsste, wenn sie einen nicht doch zum Schmunzeln gebracht hätten. Die Filme von Wes Anderson vermessen Landkarten menschlichen Leids, aber sie lassen sich nicht davon unterkriegen. Sie sind zum Heulen, verzweifelt, tauchen ein in den Weltschmerz, den das Leben unweigerlich mit sich bringt, wenn Menschen Gefühle füreinander entwickeln, die nicht erwidert werden. Aber sie erzählen doch von Triumphen in ihren strengen und leichten Kompositionen und bevorzugt mit Weitwinkelobjektiven gefilmten Bildern.
Das Gewohnheitstier
Es sind Komödien im Wilder’schen Sinne: Am Ende siegt die Hoffnung. Weil Anderson daran glaubt. Und weil er ein Gewohnheitstier ist: So sehr er sich in jedem neuen Film in eine neue Richtung reckt, so sehr bleiben die Dinge doch auch so, wie sie sind. Das betrifft die zahllosen Querverweise auf Literatur und Kultur, die Andersons Filme wirken lassen wie einen Dschungel, bevölkert von Orson Welles, J.D. Salinger, Jacques Cousteau und Satyajit Ray. Sie sind popkulturelle Füllhörner, deren spielerischer Umgang mit Vorbildern und Zitaten so etwas ist wie das Ground Zero des Hipstertums: Zeit spielt eine ebenso untergeordnete Rolle in Andersons Filmen wie genaue geografische Angaben. Um was es geht, ist die Anordnung der einzelnen Elemente, der Figuren, ihre Bewegungen im Raum. Landkarten spielen eine große Rolle in den Filmen. Und in Andersons wahrem Leben: Schon als Junge entwarf er mit seinem grafisch begabten Bruder Eric Chase Lagepläne und Querschnitte.

Dem fetischisierten Umgang mit Ordnung wohnt etwas ähnlich Zwanghaftes an wie seiner stoischen Inszenierung und dem gezielten Zusammenarbeiten mit der immer gleichen Kreativgruppe, allen voran die Autoren und Vertrauten Owen Wilson, Noah Baumbach, Jason Schwartzman und Roman Coppola, und natürlich den immer gleichen Schauspielern, die Anderson selbst seine „Gang“ nennt. Angeführt von Bill Murray, der mit Ausnahme von „Bottle Rocket“ in jedem Film Andersons eine Rolle hatte, sieht man immer wieder die Charakterschädel von prägnanten amerikanischen Schauspielern wie Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Edward Norton oder Bob Balaban. Das erinnert an die Stock-Companys großer Siebzigerjahre-Regisseure wie Martin Scorsese oder Robert Altman, ist in seiner stoischen Umsetzung aber doch Wes Anderson durch und durch. Jeder neue Film ist ein neuer Mosaikstein, der sich ins große Ganze eines OEuvres fügt, in dem sich die Figuren eines einzelnen Films mühelos in die Handlung eines anderen seiner Filme verirren könnten, wie sich eben auch die Schauspieler immer wieder doppeln und aufs Neue treffen.
Die Autorentheorie passt auf Wes Anderson so schön, weil er sich zwar im Zuge der Begeisterung um das neue amerikanische Independentkino von Quentin Tarantino, Richard Linklater, Steven Soderbergh und deren Urvater im Geiste, Jim Jarmusch, einen Namen macht und seine Anfänge im Sundance Film Institute liegen, wo er 1992 zusammen mit seinem Unikumpel Owen Wilson seinen Kurzfilm „Bottle Rocket“ workshoppte. Aber so independent Wes Anderson auch arbeiten mag, er ist kein Independent-Filmer, er dreht seine Filme fast ausschließlich für Studios – wie die legendären Filmemacher von einst, für die die Autorentheorie entwickelt worden war. Selbst sein Debüt, die Spielfilmfassung von „Bottle Rocket“, kommt im Verleih von Columbia Pictures ins Kino, nachdem der unabhängig mit Hilfe von „Besser geht’s nicht“- und „Zeit der Zärtlichkeit“-Macher James L. Brooks entstandene Film sogar vom Sundance Film Festival abgelehnt wurde.
Durchbruch mit „Rushmore“
Seinen Durchbruch erzielt Anderson zwei Jahre später mit „Rushmore“, und damit beginnt seine zunächst kometenhafte Zeit bei Disney, in der er als Wunderkind und möglicher Erneuerer des Kinos gefeiert wird: „Die Royal Tenenbaums“ ist 2001 sein erstes Meisterwerk, ein zutiefst persönlicher Film, der aber keine Grenzen zu kennen scheint und obendrein ein Hit in den US-Kinos ist. „The Life Aquatic with Steve Zissou“ soll dann Andersons Magnus Opus werden, der Abschluss seiner Trilogie über übermächtige Vaterfiguren, deren Verantwortungs- und Gewissenlosigkeit tiefe Wunden in ihre Kinder und die Menschen, die zu ihnen aufsehen, schlägt. Das zunächst massive Budget von knapp 100 Millionen Dollar wird zwar auf Andersons Betreiben um fast die Hälfte reduziert. Aber auch mit 50 Millionen Dollar Kosten ist der extravagante Abenteuerfilm bei einem weltweiten Einspiel von 34 Millionen Dollar ein so großer Flop, dass Disney die Zusammenarbeit beendet. Und Anderson acht Jahre braucht, einen kleinen, aus der Hüfte geschossenen Film wie „The Darjeeling Limited“ (sein erstes Projekt für Fox) und einen ersten Animationsfilm (die Roald-Dahl-Verfilmung „Fantastic Mr. Fox“), um wieder Fuß fassen zu können. Mit „Moonrise Kingdom“ beginnt endlich eine neue Phase im Filmschaffen Wes Andersons.
Vor Fox muss man den Hut ziehen
Er lebt mittlerweile in Paris, es geht zwar immer noch um unverzeihliche und doch liebenswerte Hallodris in seinen Filmen, aber der Rahmen hat sich verändert: „Grand Budapest Hotel“ ist 2014 der vielleicht kurioseste, aber auch ambitionierteste
Film von Anderson bislang, ein hinreißendes Caper-Movie über die ungeahnte Solidarität von Concierges von Edelhotels in den Dreißigerjahren, aber auch eine Meditation über den Aufstieg des Faschismus. Der Film trifft einen Nerv: Er spielt bei einem Budget von 25 Millionen Dollar weltweit 175 Millionen Dollar ein und taucht in fast allen relevanten Top-Ten-Listen des Jahres auf. Und ermöglicht auch „Isle Of Dogs“, einen Film so kurios und eigenwillig und verschroben, dass man anno 2018 seinen Hut ziehen will vor dem Studio (immer noch Fox), das den Mumm hat, grünes Licht für ein solches Projekt zu erteilen.
Man könnte sich gut vorstellen, wie man Anderson in einem seiner Filme sieht, er in die Kamera von der Autorentheorie erzählt, ein paar Ausgaben der „Cahiers du Cinéma“ und ein zerlesenes Exemplar von „The American Cinema“ vor sich. Und dann ein Flashcut auf seine Augen, vor denen sich eine Parade seiner Filmfiguren abspielt. Dignan. Max Fischer. Margot Tenenbaum. Mister Fox. Captain Sharpe. Und Wesley Wales Anderson. Und dazu spielt „Me And Julio Down By The Schoolyard“ von Paul Simon. Wäre das nicht schön?