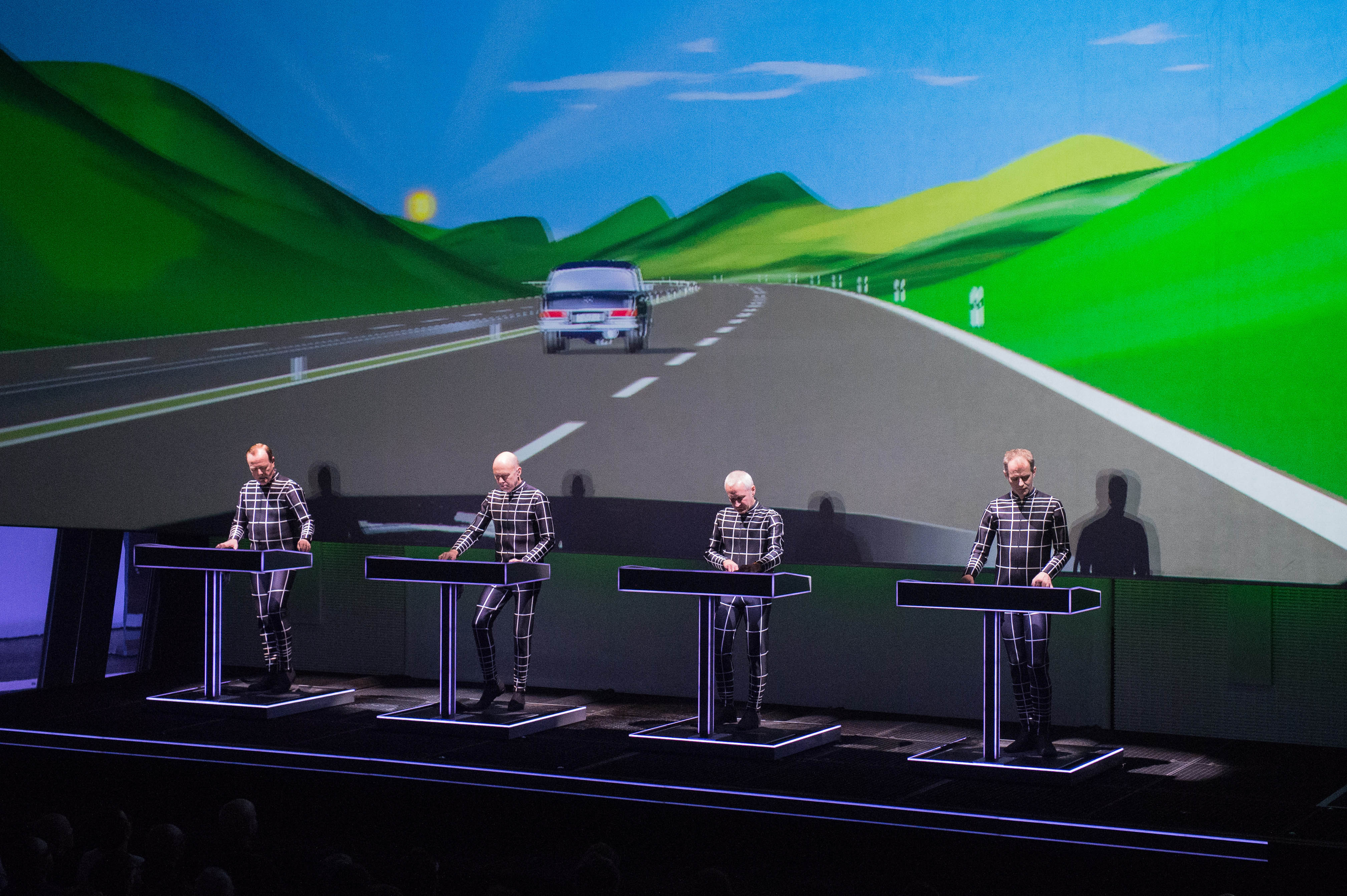Gegen die Massen
Wer wie die Manic Street Preachers alles an Erfolgen abgeräumt hat, was es gibt, hat zwei Möglichkeiten: ehrenvolle Frührente oder die Suche nach neuen Zielen. Man könnte zum Beispiel versuchen, im sechsten Anlauf doch noch die USA zu knacken. Oder aber auch das genaue Gegenteil tun...
Köln, Ende Januar 2001: Während sich im Domviertel die ersten Narren sammeln, sitzt in einem warmen Sony-Zimmer ein etwas müder James Dean Bradfield, auf dem üppigen Bauch eine akustische Gitarre, und blickt aus dem Fenster auf den „Mediapark“, der aussieht, als hätten fünf Architekten nach einem Besuch in Disneyland einen kollektiven Alptraum gehabt. James grinst verschmitzt: „Na, was gibt’s Neues?“ Zunächst mal ihn selbst. Zwar kennt man sich seit acht Jahren, aber als jovialen, gemütlichen Menschen hat der Reporter sein Gegenüber nicht in Erinnerung. Wenn Bradfield an den James von 1993 zurückdenkt, sieht er „einen verschüchterten Jungen, umgeben von verwirrten Leuten, die nichts verstehen, weil er so schnell redet. Unsere Wut hatte damit zu tun, dass manche Leute behaupteten, die Zeit für Rockbands sei vorbei, wir seien eine archaische Erscheinung. Wir wollten I, ihnen beweisen, dass sie Unrecht hatten.“
In ihren frühen Jahren gab sich die Band alle Mühe, diesen Beweis anzutreten: Ihre T-Shirts zierten präpotente Slogans wie „All Rock’n’Roll Is Homosexual“, „Suicide Babes“, „I Hate American indie Rock“, in Interviews schimpften sie i eloquent auf alles, wonach man sie fragte. Statt in Lumpenklamotten und Baggy-KIuft herumzulaufen, kleideten sie sich wie eine Barbie-Version der New York Dolls, und die Galerie ihrer Vorbilder war eine seltsame Mischung aus Guns N‘ Roses, Marx, Rimbaud, Public Enemy, Nietzsche, Camus und Konfuzius, deren Zitate ihre Platten zierten. Der Preis für den Angriff auf die Welt war hoch: Statt vom ersten Album wie angekündigt 16 Millionen Stück zu verkaufen und sich aufzulösen, durchkroch die Band alle Niederungen von Spott und Verachtung, verlor auf dem Weg ’95 ihren Texter und „Gitarristen“ Richey Edwards, der spurlos verschwand, und erntete erst ’96 mit dem Album „Everything Must Go“ den Lohn für die Mühen. Danach lieferte das Trio mit „This Is My Truth, Tell Me Yours“ ein ermüdendes Stadionrock-Album ab, absolvierte eine Dienst-nach-Vorschrift-Welttournee und zog sich nach einem Auftritt vor 65.000 Menschen in Cardiff an Silvester 1999 zurück endgültig, wie mancher meinte. Gerüchte über ein Best Of-Album mit dem Titel „Forever Delayed“ als letztes Statement machten die Runde.
Doch wieder mal kam alles ganz anders: Enttäuscht darüber, dass sie zu „gewöhnlichen“ Rockstars degeneriert waren, stürzten sich die Manics in ein Abenteuer, an dessen Ende das neue Album „Know Your Enemy“ steht. Der Titel war Programm: „Der Feind war das, was aus uns geworden war“, verkündete Bassist und Texter Nicky Wire. „Wir hatten zwei Regeln“, sagt James. „Erstens: Nichts wird geprobt. Es gibt eine Art Gesetz für alle Bands: Bevor du ins Studio gehst, musst du in ein Probestudio. Diesmal hatten wir nur vier Songs. Die anderen Sachen haben wir drei-, viermal gespielt, spätestens beim dritten Take waren sie fertig. Zweitens: keine Streicher. Okay, auf ‚Miss Europa Disco Dancer‘ hört man welche, aber das sind Keyboards. Als wir anfingen, war alles ein totales Desaster. Es klang wie Public Image Limited – und wir haben beschlossen: Genau so machen wir’s!“
Das Ergebnis ist so vielseitig, dass sich beim ersten Hören Verwirrung einstellt: Zwischen Lärm und Ballade ist so ziemlich alles zu finden, was passieren kann, wenn drei Leute drauflos spielen, von denen einer ein geniales Gespür für Melodien und einer seine Schnauze wiederentdeckt hat, die ihn einst berühmt-berüchtigt machte. Nick Wire singt nicht nur seinen „Wattsville Blues“ selbst, er ist auch auf der kuriosen Disco-Nummer „Miss Europa Disco Dancer“ zu hören: „Braindead motherfuckers!“, raunt er da über die Auslaufspur. „In Spanien hatten wir Sky TV im Studio und sahen dieses ‚Big Brother‘-Zeug, wo sie zehn doofe, geile Leute in eine Villa tun und zusehen, wie sie sich besaufen, Drogen nehmen, ficken“, erklärt James. „Darum gab es ‚Jamaica Uncovered‘, genau das gleiche. Es war wie eine Verschwörung der TV-Produzenten, und wir dachten: Wenn wir das noch länger anschauen, werden wir hirntote Arschlöcher.“
Richtig ernst war es James mit seinem ersten (beendeten) Versuch als Texter. Die anrührende Semi-Ballade „Ocean Spray“ ist seiner Mutter gewidmet, die am 27. Juli 1999 an Krebs starb. „Sie war in einem dieser uralten Krankenhäuser, die es wohl nur noch in Großbritannien gibt. Die haben da große Angst vor Infektionen, deshalb empfehlen sie den Leuten, viel Cranberry-Saft zu trinken. Also schickte mich meine Mutter dreimal am Tag los, ihr ‚Ocean Spray‘-Saft zu holen. Das hat mich beeindruckt: Dass jemand, der dem Sterben so nahe ist, sein ganzes Vertrauen in eine Tüte Saft setzt. Es sagt was über den menschlichen Geist, dass man immer glaubt, es könne noch eine Chance geben.“
Der Tod von James‘ Mutter fiel in eine Zeit, als sich manches änderte – etwa die erste Ziffer in den Altersangaben der drei Musiker, und damit die Einstellung zum Leben: Beschleicht nicht jeden um die 30 gelegentlich das Gefühl, mehr hinter als vor sich zu haben, mehr Erinnerungen als Erwartungen? Lieber alte Sachen wieder zu entdecken als neue zu finden? „Ja, stimmt. An Weihnachten war ich drei Wochen im Haus meines Vaters. Ich hab meine alten Platten durchgewühlt und zum Beispiel das erste Saints-Album gefunden, ‚I’m Stranded‘, das hatte ich total vergessen. Viele Leute verändern sich mit 30, aber ich denke, es fangt auch was Neues an, wenn Dinge zurückkommen. Vieles kommt einem jetzt viel besser und wichtiger vor als damals.“
Zurück In die Zukunft. Die Live-Aktivitäten zu „Know Your Enemy“ beginnen an einem Ort, wo noch nie eine Band aus der kapitalistischen Welt aufgetreten ist: in Kubas Hauptstadt Havanna. Wie kam das zustande? „Als wir das Album durchhörten, fragte jemand: Wieso spielt ihr so oft auf Kuba an? Es sind drei oder vier Reverenzen an Kuba drauf: eine Stelle in The Convalescent‘, ‚Baby Elian‘, ,Let Robeson Sing‘. Da sagte Nick: ‚Es wäre Wahnsinn, wenn wir den ersten Gig auf Kuba spielen würden‘. Unser Manager Martin meinte: ‚Ich sehe mal, was sich machen lässt.‘ Das war’s. Ich denke aber auch, dass die Geschichte eine Bedeutung hat. Viele Leute halten uns für überholt und altmodisch, politisch glorreich gescheitert. Und viele Leute sehen Kuba genauso.“ Hat der Kuba-Plan nicht auch damit zu tun, dass die Manics in den LISA noch nie ein Bein auf den Boden bekommen haben? „Nein, aber nachdem es so aussah, als würde die Sache klappen, haben wir überlegt: Wenn wir für Kuba Arbeits-Visa brauchen, können wir danach nie wieder auf LISA-Tournee gehen. Die perfekte Entschuldigung!“ Und wieder grinst James wie ein kleiner Junge, der sich für einen gelungenen Streich nicht so recht schämen mag.
14. Februar, Havanna. Wenn es diese Stadt nicht gäbe, könnte sie auch keiner erfinden; der außergewöhnliche Anlass sorgt in mancher Hinsicht noch für eine Steigerung: Betrunkene Waliser filmen inmitten grinsender Cuba-Carabinieri die Ankunft ihrer noch betrunkeneren Kumpels, das Taxi brettert mit 120 Sachen durch Schwaden von historischen Abgasen, vorbei an grotesken Chevy-Fossilien, buntscheckig wäscheverhängten Wohnklötzen und verblichenen Schildern mit der Aufschrift „Ins neue Jahrtausend mit Fidel und der glorreichen Revolution“ in die Innenstadt. Es ist „Dia de los Enamorados“ – der Tag der Verliebten, und die kilometerlange Mauer an der Strandpromenade Malecon ist vollbesetzt mit solchen; ob die große Party irgendwann endet, bleibt dem müden Europäer schlafbedingt verborgen. Man kennt das Klischee: Auf Kuba werde gearbeitet, wenn der Bus fährt; der fährt, wenn es Benzin gibt; das gibt es nicht, also wird gefeiert. Die Wirklichkeit sieht (etwas) anders aus: Überall in Havanna sind Restaurierungsarbeiten im Gange. Die laufen zwar meist so ab, dass einer pinselt, der zweite auf Mörtel wartet und der dritte in der Schubkarre schläft, aber man spürt: Hier bewegt sich was. Durch die Straßen dröhnt eine wilde Mischung aus Rap, Salsa, Kindergeschrei und Motorenlärm; überall wird etwas getan, auch wenn manchmal nicht ersichtlich ist, was. Vom Standpunkt der globalisierungswütigen Wirtschaft aus betrachtet ist all das nicht genug. Ginge es nach den Vorstellungen gewinnorientierter Ökonomen, würde die Insel in ein Paradies aus Werbung, Konsum und Profit verwandelt. Wird sie aber nicht – weil es ein alter Revolutionär, der immer noch an die Segnungen des Sozialismus glaubt, so will. Castro stürzte 1959 den seit 1933 auf Kuba regierenden Diktator Bastista. Nach dem Putsch sollte alles besser werden. Doch der Wohlstand für alle blieb aus. Stattdessen herrscht heute – allen Bemühungen zum Trotz – vielerorts der Verfall. Was all das mit den Manie Street Preachers zu tun hat? Ganz einfach: Beide – Fidel Castro genau wie die fidele Band – verabscheuen die Macht des Kapitals und demzufolge auch Amerika.
Freitag, der 16. Februar, Interviewtermin. Der Weg zum internationalen Pressezentrum führt am legendären Hotel Nacional vorbei, einem 1930 mit Geldern der (heute exilierten) Mafia erbauten Prunk-Palast. Von hier ist es für die Manics nur ein kurzer Fußmarsch zur Pressekonferenz mit 120 einheimischen oder bereits deutlich sonnenverbrannten Reportern. Nicky Wire führt das (für die Dolmetscherin nicht immer rätselfreie) Wort; James und Drummer Sean Moore halten sich zurück. Das größte Interesse gilt den Punkten, wo sich Manics und Kuba berühren. Zum Beispiel dem Song „Baby Elian“. Der sei nicht bloß auf den Jungen Elian Gonzalez bezogen, um den zwischen Kuba und den USA ein heftiger Streit entbrannte, sondern laut Nick „ein Kommentar dazu, wie sehr die US-Medien die Meinung der ganzen Welt beherrschen“. Kuba wehre sich tapfer gegen die Kulturhegemonie: „So was wie Limp Bizkit gibt es hier immerhin nicht, diese widerliche Band, die wir in Großbritannien jeden Tag hören müssen.“ Ob die Chancen der Band in den Staaten durch die Kuba-Geschichte nicht gemindert würden? „Das hoffe ich!“ Freundliches Lachen. James stellt den kubanischen Gitarristen Dago vor, den er am Abend kennen gelernt und zu einer Session beim Soundcheck eingeladen hat. Dann werden die Fragen schärfer: Steckt hinter der ganzen Aktion nicht ein PR-Trick? „Die kubanischen Medien“, schimpft Sean, „sind viel offener, interessierter und freundlicher zu uns, als es die britischen je zu kubanischen Musikern waren.“
Es wäre „die größte Ehre , wenn Fidel Castro persönlich zum Konzert erschiene, grinst Nick. Nachdem noch einmal gesagt wurde, dass es hier neben anderen Überlegungen („Unsere letzte Tournee haben wir in der langweiligsten Stadt der Welt begonnen, diesmal wollten wir das Gegenteil tun!“) auch um eine „Geste der Solidarität“ geht, trennen sich die Wege: die Band zurück ins einladende, weil wenig sozialistische Hotel, der Rest muss noch Visa, Filme, Zigarren oder Rum besorgen.
Um halb sieben versinkt die Sonne in einem Meer aus Quecksilber. Das Teatro Karl Marx steht eine halbe Stunde vom Hotel Nacional ziemlich allein zwischen Ufer und dem Stadtteil Miramar, wo die Alleen zu Tunnels und die Vorgärten zu kleinen Dschungeln verwachsen sind. Über den Taxiparkplatz vor dem Bau hallen in der milden Abendluft die brachialen Akkorde von „Found That Soul“. Die Manics machen Soundcheck. Sonst deutet nichts auf das bevorstehende Ereignis hin. 24 Stunden später sieht das anders aus: Die Straße ist weiträumig abgesperrt, die Ordner an den Barrikaden lassen nur Fußgänger passieren. Vor der Halle ungeordnete Schlangen aus minderjährigen Kubanern, unter die sich grinsende Erwachsene und auffällig bleiche Briten mischen. Aufregung liegt in der Luft, in einem Häuschen nebenan werden die Kameras der Journalisten einer mysteriösen Prüfung unterzogen.
Langsam füllen sich die Sitzreihen vor der Bühne und auf den beiden Balkonen. Eine Handvoll Ordner an den drei Glastüren verteilt rote Fähnchen mit der Aufschrift „Manie Street Preachers Cuba 17-02-01“, und einer der eifrigen Kulturbeamten, die sich um die auswärtigen Berichterstatter kümmern, flüstert mir erregt zu: „Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, Fidel Castro zu fotografieren!“ Wann? Wo? „Hier. Er kommt wahrscheinlich gleich.“ Tatsächlich: Als die meisten der 4.900 Plätze besetzt sind, stehen plötzlich alle wieder auf, drehen sich um und wedeln mit ihren Fähnchen. Da leuchtet ein grauer Bart in der Mitte des unteren Balkons, der alte Mann dazu winkt freundlich und setzt sich in die erste Reihe. Maximo Lider is in the house! Kurz darauf gilt der Jubel dem anderen Ende des Saals: Vor einer überdimensionalen Kuba-Flagge betreten die Manics die Bühne und entfesseln mit „Found That Soul“ ein Lärmgewitter, das den ehrwürdigen Schauplatz manch historischen Kongresses in den Grundmauern erschüttert. Das Programm ist eine ausgewogene Mischung aus Alt und Neu, wobei die Alben „Gold Against The Soul“ und „The Holy Bible“ leider ausgespart werden. Auf „Found That Soul“ folgt „Motorcyde Emptiness“, für „Kevin Carter“ und „Ocean Spray“ verstärkt ein kubanischer Trompeter die Band. Spätestens nach „The Masses Against The Classes“ erinnert die Atmosphäre an die ersten Auftritte der Rolling Stones vor frenetischen Horden deutscher Teenager Mitte der 60er Jahre. Aber immer wieder schaltet die Band einen Gang zurück, und als James ganz allein zur Akustischen „Baby Elian“ singt, erhebt sich Castro und applaudiert – klar – minutenlang. Für Verwirrung sorgt Nick mit dem für kubanische Ohren etwas arg schrägen „Wattsville Blues . Die ohrenbetäubenden Akkorde von „You Love Us“ und „Motown lunk“ steigern die Begeisterung schließlich zur Raserei – die Textzeile „I laughed when Lennon got shot“ verkürzt James allerdings auf „I laughed“: In Havanna steht seit einiger Zeit ein Denkmal für den Ex-Beatle. Dann, nach einer monumentalen Version von „A Design For Life“, ist Schluss. Die Band winkt, Castro geht – und versäumt so das höchst ungewöhnliche Ereignis von gleich zwei Manics-Zugaben. Jetzt löst sich die Sitzordnung endgültig auf, James bittet (vergeblich) das Publikum, die Strophen von Chuck Berrys „Rock’n’Roll Music“ zu singen, die er vergessen habe – der Oldie wird zum Halb-Instrumental. Und unterstreicht noch mal die neue Experimentierlust einer Band, die man in den letzten Jahren selten so ausgelassen und gut gelaunt gesehen habe. Draußen auf dem Platz sieht es dann kurz so aus, als wollte sich die seit Tagen anhaltende Hitzewelle in einem Gewitter entladen, um das Ereignis zu krönen. Aber die Wolken verfliegen schnell wieder. Flink sind auch die Medien: Eine halbe Stunde nach dem Konzert meldet die Sprecherin der Nachrichtensendung „En tres minutos“, Commandante Castro habe einem Konzert der „grupo musicale británico de rock Manik Estret Bretschers“ beigewohnt. Und, na klar, „eine Geste der Solidarität mit der Unabhängigkeit unserer Insel.“
Auf der spätabendlichen After-Show-Party im kolossalen „Salon 1930“ des Nacional tummelt sich zu einheimischer Live-Musik ein buntes Völkchen: Sean fachsimpelt mit seinem neuen Freund vom Ministerium über Mobiltelefone, James schüttelt Hände und „Cristal“-Bierflaschen, der legendäre Boxer Felix Savón (die „Faust der Revolution“) ist einfach er selbst, Lauf-Veteran Alberto Juanterino lächelt dazu. Die Barmänner sind sichtlich überfordert, eine neue Form der Devisenknappheit tritt ein: Das Bier muss verbilligt werden, weil keine Pesos mehr als Wechselgeld da sind. Auf die Frage, ob Fidel vor dem Konzert die Texte der Manics gelesen habe, schüttet sich der Kultur-Mann schier aus vor Lachen: „Was meinst du? Ich kann es mir schon vorstellen!“ James, immer breiter grinsend, erzählt von der Backstage-Begegnung mit Castro: „Wahnsinn! Da kommt ein Typ zu uns und sagt, wenn wir Lust hätten, könnten wir in der Garderobe ’somebody‘ treffen. Wir machen die Tür auf, und da sitzt er! Wir haben rumgezappelt wie die Blöden und am ganzen Körper gezittert!“ Und Nick hat – was eigenartigen Humor angeht – in dem bärtigen Dauerrevolutionär seinen Meister gefunden. Auf den Hinweis, ihm sei hoffentlich klar, dass es ein ziemlich lärmiger Abend werde, antwortet Castro: „Bestimmt nicht so lärmig wie ein Krieg!“
Irgendwann kurz vor Sonnenaufgang geht Havanna schlafen. Auf dem Weg durch einsame Nebenstraßen macht sich ein seltsames Gefühl bemerkbar: So etwas wird es nicht mehr geben. Aber wenn man den Ankündigungen der Band glaubt, ist Havanna nur die erste einer ganzen Reihe spektakulärer Aktionen im Jahr 2001 gewesen. „Es gibt noch so viel zu beweisen!“ hat James in Köln gesagt. Wer die Manie Street Preachers immer noch für eine „archaische“ Erscheinung hält, dem könnte demnächst Hören und Sehen vergehen.
www.manicstreetpreachers.com