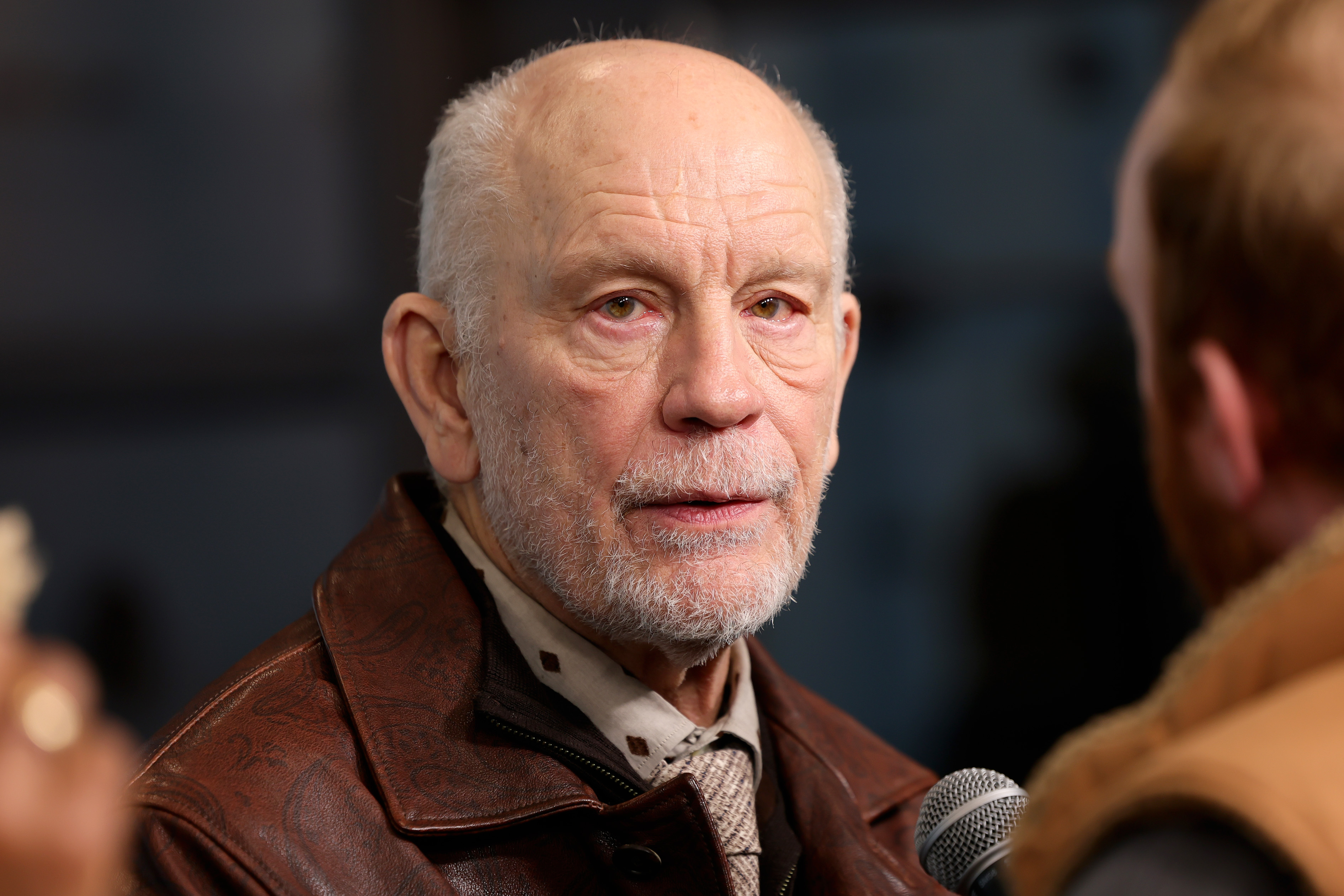Zurück in die Zukunft

Die New Yorker Band The Drums will die Popmusik nicht neu erfinden, bloß ans Ende aller Zeit führen. Ihre Währung: Unsere Sehnsucht. Die ewige Jugend. Der amerikanische Traum. Und: Perfekte Planung

Später, auf dem Weg vom „Empress Ballroom“ zurück ins Hotel, sitzen Adam, Connor und Jacob schweigend um den Einbautisch des Tour-Vans herum, und dann fragt Adam in die Stille hinein, warum Jonathan denn so schnell verschwunden sei.
„Irgendwas stimmt nicht mit ihm“, sagt Jacob. Dann ist es wieder still, und alle hängen im Dunklen des Wagens ihren späten Gedanken nach, während draußen die Innenstadt von Blackpool vorbeizieht, schummerig beleuchtet und menschenleer. Die Saison hat noch lange nicht begonnen. Es ist Sonntag, der Sommer weit, die Heimat auch.
Blackpool: Brighton des englischen Nordwestens, Seebad der Schotten, Liverpooler und Mancunians; ein Sehnsuchtsort für die, die eigentlich nicht weg wollen, sondern nur das gleiche sehen wie immer, aber mit Meerblick; ein Vergnügungsstädtchen, gemacht aus großen Clubs und kleinen Pensionen, einer schnurgeraden Uferpromenade, einem Eiffelturm-Fake, einem Rummel und Wind, ganz viel Wind. Hierher fahren die Junggesellen und Junggesellinnen mit ihren Freunden, um sich am letzten Abend in Freiheit, bevor die Glocken zur Hochzeit läuten, noch mal so richtig das Hirn wegzuschießen. Wenn du in Blackpool nicht um dein Leben geheult und gekotzt hast, warst du nicht wirklich da. Was für ein fantastischer Ort, um ins Meer zu gehen, für immer.
The Drums sind hier irgendwie, ja: gestrandet. Schon den dritten Tag. Sie haben am Freitag gespielt, am Samstag frei gehabt, an diesem Sonntagabend wieder gespielt. Der „Empress Ballroom“, im Jahr 1896 in den bestehenden Komplex des noch älteren „Winter Gardens“ hineingebaut, ist eine Art überdimensionierter viktorianischer Tunnel, 60 mal 35 Meter, reichverzierte Holzdecke, riesige Kronleuchter, in Tausenden Tanzstunden abgetretenes Eichenparkett, einer der größten und schönsten Ballsäle der Welt.
The Drums, zum Jahreswechsel Nummer eins auf der NME-Vorhersageliste für die Newcomer 2010, Nummer eins im Leserpoll von Pitchfork für die „Hoffnung 2010“, und das alles nur auf Basis einer einzigen bis dahin erschienen EP, „Summertime!“ und ein paar ikonographischen Bildern des Fotografen Hedi Slimane, der die Jungs aus New York schon mit Sternenstaub berieselte, lange bevor überhaupt jemand die Band auf dem Zettel hatte.
The Drums sind im Vorprogramm unterwegs. Von Florence & The Machine. Auf Tour durch Irland, Schottland und England, einen Monat, bevor das Debütalbum der Drums erscheint. Eine halbe Stunde Auftritt pro Termin, Zeit für acht, neun Songs, während der Raum sich noch füllt, die Leute aufgeregt quasseln und sich für Bier anstellen. Die Überschneidung zwischen dem Publikum von Florence und dem potenziellen der Drums dürfte bei, sagen wir: unter fünf Prozent liegen.
Am Sonntagabend zum Beispiel ist da ein Mann, offensichtlich ein Einhemischer, Mitte 30, Typ später Lad, seine Freundin hat sehr blonde Strähnen, er fragt, ob man die Band kenne.
Ja.
„Wie heißen die?“
The Drums.
„Einfach so, wie das Instrument?“
Einfach so. Einfach, mein Freund, ist das Schwierigste.
„Woher?“
New York City, aber das ist nur die halbe Geschichte, der Rest wäre in diesem Moment zu kompliziert zu erklären. Aus New York City kommt eigentlich nur der Schlagzeuger, und im herkömmlichen Sinne wohnen tut niemand von denen gerade da. Wie gesagt: Es ist kompliziert. Und es gibt die Band noch nicht mal seit einem Jahr.
„Okay.“ Der Mann zuckt mit den Schultern, dreht sich wieder zu seiner Freundin und ruft ihr irgendwas ins Ohr, während oben auf der Bühne Jonathan „Down By The Water“ singt, viel exaltierter noch als auf Platte, sehnsüchtiger, beschwörender. Er trägt die Klamotten eines amerikanischen Halbstarken, hochgekrempelte Jeans und bis zum Schulteransatz ebenfalls hochgekrempelte Hemdsärmel. Die klassische Uniform des amerikanischen Traums also. Jonathan zerhackt die Luft mit den Armen und wiegt die Hüften im Rhythmus der traurigen Melodie.
„Down By The Water“ ist ein kurzes Lied über die Liebe, wie es nur jemand singen kann, der noch jung genug ist, um an sie zu glauben. Oder der zumindest den Glauben noch glaubhaft vorspielen kann. Der Song klingt wie eine Reminiszenz darauf, wie heute, dreißig Jahre später, eine New-Wave-Ballade klingen müsste, die eine Rock’n’Roll-Ballade nachgespielt hätte, damals auch schon dreißig Jahre nach Rock’n’Roll. Aber hier geht es nicht um musikhistorische Verweise. Sondern darum, mit den einfachsten Mitteln der Popmusik von der größtmöglichen Unschuld zu erzählen, von Sehnsucht, von der ersten Liebe, und dafür die schönsten, eindringlichsten Bilder zu finden; und die Töne dazu sollen nach etwas klingen, das man entfernt kennt; etwas, das man Zuhause nennen könnte oder sogar: Heimat.
Diese Heimat ist kein Land, keine Gegend und kein Ort, man findet sie auf keiner Landkarte, in keinem Geschichtsbuch und auf keiner einzelnen alten Platte, denn sie existiert nur in der Erinnerung; aber nicht als persönliche und nicht als irgendeine kollektive. Sondern als Einbildung, als Idealisierung. Als Hoffnung derjenigen, die sich nicht erinnern können, weil sie nicht dabei waren: So könnte es gewesen sein, als alles gut war; so könnte es geklungen haben, als die Liebe neu war. Die Heimat der Drums ist die Popmusik selbst, in ihrer verklärtesten Form: Sie wollen keine Töne und keine Klänge nachspielen, sondern die Gefühle, die bestimmte Töne und Klänge auslösen oder einmal ausgelöst haben. Vielleicht.
If you fall asleep down by the water, baby, I’ll carry you all the way home. You’ve gotta believe me, when I say… When I say the word „forever“. And whatever comes your way, oh, we’ll still be here together. I know it’s hard, I know it’s hard… But I understand you. Just take my hand.
„Ich kann noch gar nicht glauben, dass diese Band ein Erfolg werden soll“, sagt Gitarrist Jacob. „In meinem Leben hat noch nie was geklappt, noch nie.“ Er grinst, um die Übertreibung etwas zu offensichtlich zu unterstreichen, dann kaut er weiter zufrieden auf dem Hähnchen, das die Küche für ihn warmgehalten hat. Bassist Adam schaut abwesend auf seinen Salat, Schlagzeuger Connor schiebt seine Gnocchi etwas angewidert weg, Sänger Jonathan hat gleich gesagt, er habe keinen Appetit. The Drums sitzen um einen Tisch herum im Backstage-Bereich des „Empress Ballroom“, hinter ihnen schieben ein paar Roadies Verstärker und Instrumentenkoffer herum. Vor einer halben Stunde sind The Drums von der Bühne gekommen, kurz nach neun Uhr, Feierabend.
„Wisst ihr, was in acht Tagen ist?“, fragt Jonathan in die Runde. Schulterzucken.
„Hey, Leute: das Jubiläum!“ Das Einjährige. Am 17. Mai 2009 sind sie zum ersten Mal aufgetreten, im „Cake Shop“, Ludlow Street, Lower East Side, Manhattan, vor vielleicht fünfzig Leuten. Eigentlich wollten sie zum Jubiläum da wieder spielen, aber dann kam die isländische Aschewolke, die alle Termine durcheinander gewirbelt hat, Flüge, Promotermine, Konzertplanungen, und eine der vielen Folgen davon ist nun, dass The Drums in Blackpool gelandet sind.
Connor geht vor die Tür, eine rauchen. Connor ist der Letzte, der dazu kam, der Einzige ohne persönliche Vorgeschichte mit den anderen. Jonathan und Adam sind im selben Kaff in Upstate New York aufgewachsen, Horseheads, 20.000 Einwohner und kein Wahrzeichen, sie haben vorher schon mal in einer Band zusammengespielt, die Elkland hieß und einen Vertrag beim Majorlabel Columbia hatte, im Jahr 2005 ist das Debütalbum erschienen und danach nur noch eine Single. Es ist eine Menge schiefgelaufen, der übliche Mist: junge Menschen und Plattenfirmen.
Jonathan und Jacob wiederum haben sich schon als Zwölfjährige in einem Zeltlager in Pennsylvania kennen gelernt, sie hatten den gleichen Musikgeschmack, was eigentlich vollkommen unmöglich war, denn welche Zwölfjährigen fanden 1995 wohl sonst noch in Amerika die Smiths und Joy Division gut, da hätte man lange suchen können. Jacob kam auch vom Land, aber aus Ohio, das war ein bisschen weit weg. Mit einem Freund namens Drew Driver gründete Jacob später seine eigene Band, Horse Shoes, sie unterschrieben beim Indie-Label Shelflife. Da lief dann auch eine Menge schief.
Connor steckt sich eine Marlboro an und sagt, dass das ganz schön seltsam sei, hier nun in Blackpool herumzustehen; und dass er, bevor das losging mit den Drums, noch nie im Ausland war. Aber außer Jacob ginge es den anderen ja genauso, und Jacob sei auch bloß auf Urlaub mal irgendwohin geflogen. Jetzt sind sie seit drei, vier Monaten unterwegs durch die Welt, das kann einen schon durcheinander bringen: Die Welt zu sehen, die man sich immer nur vorgestellt hat. Am Tag zuvor, dem freien, ist Connor früh aufgestanden und in die Stadt gegangen, aber nach einer halben Stunde wurde ihm langweilig. Eine Tour ist keine Bildungsreise, und wenn niemand da ist, den du vom Meer hochtragen kannst, all the way home, dann bringt es auch nichts, aufs Wasser zu starren.
Dann fährt Connor sich mit der freien Hand durch die Haare, die immer ein bisschen ungewaschen aussehen. Er schaut anders aus als die anderen, unpropperer, gebrochener. Man sieht ihm die große Stadt an. Und die Scheiße, die New York ihn hat fressen lassen, jedenfalls glaubt man das in seinen immer seltsam gehetzt guckenden, vielleicht ja auch nur sehr wachen Augen lesen zu können. Connor war faktisch obdachlos, bevor er Schlagzeuger bei den Drums wurde, er hat bei Freunden gewohnt, mal hier, mal da, wer halt gerade ein Bett frei hatte. Jonathan, Jacob und Adam haben Connor am Tag des ersten Konzerts engagiert, ein gemeinsamer Freund hatte sie kurzfristig zusammengebracht, die Drums brauchten noch einen Drummer, ja, der Witz ist zu naheliegend. Um sechs trafen sie sich vor einem mexikanischen Restaurant an der elften Straße in Manhattan, um sieben haben sie das erste Mal geprobt, um acht gingen sie im „Cake Shop“ auf die Bühne, 17. Mai 2009.
Es gibt auf YouTube ein Handy-Video von dem Auftritt, sie spielen „Let’s Go Surfing“, die allererste Single, eine Hurra-Popnummer, wie man sie so unverstellt und ungebrochen seit Ewigkeiten von keiner anderen Band mehr gehört hat. So als wären die sechziger Jahre nie zuende gegangen. So als ob Jungsein nie was anderes sei als die pure Freude. So als wäre Jugend nie zum Problem geworden, Gewalt, Drogen, Sozialpädagogen nie erfunden worden.
Der Unterschied zwischen den vier Jungen im „Cake Shop“ und denen am Abend auf der Bühne des „Empress Ballroom“ ist riesig, auf dem YouTube-Video sieht man, wie Jonathan vor einem Jahr noch eher verzweifelt versuchte, irgendwie flamboyant zu wirken, es ihm aber noch kaum gelang; wie Jacob verhuscht auf seine Gitarre starrt und Adam auf seinen Bass. Nicht nur wegen der Handy-Aufnahme ist der Sound reiner Müll, auch das Zusammenspiel der Band funktionierte da noch nicht, sie klangen hölzern, eben mehr gewollt als gekonnt. Für einen Moment nur sieht man den Schlagzeuger durchs Bild wischen, und man könnte schwören, dass das gar nicht Connor ist.
Wake up, it’s a beautiful morning. Honey, while the stars are still shining. Wake up, would you like to go with me? Honey, take a run down to the beach. Oh, Mama, I want to go surfing. Oh, Mama, I don’t care about nothing.
„Wenn wir uns nicht so sicher gewesen wären“, sagt Jacob, „wären wir wahrscheinlich verrückt geworden. Weil alles so schnell ging. Weil alle um uns herum plötzlich völlig durchdrehten: Das erste wirklich neue, große Ding aus New York seit den Strokes – vergesst Brooklyn und all das Gefrickel! Heilige Scheiße, das kann einem schon Angst einjagen. Aber es gab gar keinen Platz für Zweifel, Selbstzweifel. Als die Idee zu den Drums geboren wurde, fühlte es sich so an, als ob nun endlich alles an seinem Platz wäre. Als wäre es so vorbestimmt. Wir hatten lange genug herumexperimentiert in anderen Bands, nun galt es, an etwas zu glauben.“
Was die Drums neben vielen anderen Dingen von vielen anderen Bands unterscheidet, auch denen der Brooklyn-Bohème der letzten zehn Jahre, ist die Tatsache, dass die Drums eine von vorneherein genau geplante Band sind. Die Idee, das Konzept, der Look, der ganze verdammte Überbau stand, bevor es auch nur einen einzigen Song gab.
Jonathan und Jacob, die alten Freunde aus Zeltlagerzeiten, haben sich das alles ausgedacht. Als Verzweiflungsreaktion auf ihr Scheitern mit und in den anderen Bands davor. Jacob hatte es nach Florida verschlagen, Jonathan irrte eher heimatlos umher, als sie vor etwa zwei Jahren anfingen, sich gegenseitig Fotos zu mailen, Stimmungsbilder eigentlich, die in ihrer Summe so etwas wie das Moodboard ihrer perfekten Band wurden. Darunter waren fast keine Fotos von Bands oder Musikern, sondern vor allem solche von Sportlern und Schauspielern, alles sehr alte Aufnahmen: Speerwerfer, Rugby-Spieler und Ruderer; James Dean und Marlon Brando.
Vor Jonathans und Jacobs Augen entstand das Idealbild eines untergegangenen Amerikas, das keinen genauen Datumsstempel hatte, nicht mal einer Epoche zuzuordnen war, auch wenn die fünfziger und sechziger Jahre häufiger in den Fotos zu sehen waren als andere Jahrzehnte. Das Entscheidende aber waren die Gefühle, die sie zugleich symbolisierten und noch immer auslösten, Freiheitsdrang, Zuversicht, Fortschrittsglaube; und die Geschichten, die sie zu erzählen schienen, von denen die wichtigste und epischste immer wieder von jungen Männern handelte, die dem Leben in der Kleinstadt und auf dem Land den Rücken kehren und in die große Stadt ziehen, immer der Freiheit entgegen, der Sonne, dem Meer, der Liebe, dem besseren Leben. Die für immer jung blieben. Und in einem Land leben, das für das Gute steht. Es ist eine Hommage an jene Zeit, als Amerika noch heile war, der amerikanische Traum intakt, an die Zeit, bevor Nixon das Land mit Lügen und Intrigen vergiftete, bevor die Kinder der Weltmacht in Särgen zu Tausenden vom anderen Ende der Welt heimgeschickt wurden. Eine Blaupause des „Pursuit Of Happiness“.
So sollten auch die Geschichten von Jonathan und Jacob weitergehen, zwei damals 25-jährigen, halbwegs desillusionierten Musikern. Beziehungsweise: Ihre perfekte Band würde genau diese Geschichte in ihren Songs erzählen, die einfachen, schwierigsten, von denen die besten bloß zwei Themen haben, die Jungsein zu einer so lodernden Erfahrung machen, vielleicht: die Euphorie der gewonnen ersten Liebe und den Schmerz der verlorenen ersten Liebe.
Das musikalische Konzept, das sich aus diesem Moodboard herleitete, war so simpel wie bestechend: Wenn alles schon gesagt, gesungen und gespielt ist, man also alle Hoffnung auf ästhetischen Fortschritt in der Popmusik fahren lassen muss, dachten Jonathan und Jacob, dann besteht die Zukunft der Popmusik darin, dass man für sie einen neuen Begriff von Zeitlosigkeit erfindet. Den kann man zunächst nur aus der Vergangenheit herleiten. Weil sie aber keine Retro- oder Revivalmusik machen wollten, sondern eben im Wortsinn klassisch moderne Popmusik, müsste man dann allen Zierrat weglassen, der die Lieder einer bestimmten Epoche zuordnen würde. So weit es eben geht. Man müsste also roh und schnell arbeiten, man müsste in der Musik vorgehen wie der junge Ernest Hemingway, der große klassisch-moderne Short-Story-Schreiber, es in der Sprache tat: die Adjektive streichen. So weit es eben geht. Substantive und Verben. Gesang und Gitarre, Bass und Schlagzeug. Der Kern.
Man kann das alles entweder für irre romantisch halten. Oder für komplett übergeschnappt. Es ist in jeder Hinsicht sehr amerikanisch. Jonathan fuhr nach Florida und schloss sich mit Jacob ein, bis sie 30 Songs zusammen hatten.
Dann rief Jonathan seinen alten Bandkollegen Adam an, ob er den Bass spielen wolle.
Dann fuhr Jonathan nach New York und besorgte der Band einen Vertrag.
Dann formulierten Jonathan und Jacob eine Anweisung, an die sich Fotograf zu halten hätte, die man aber auch als Manifest lesen kann: „Die Idee hinter dem Look von The Drums ist, jede Fotografie so zeitlos wie möglich erscheinen zu lassen. Dies ist eine klassische Band, die für größere Dinge bestimmt ist als einen Moment. Alles trendige oder momentbezogene muss um jeden Preis vermieden werden. Wir wollen ein starkes Gefühl von Nostalgie und Bekanntheit erzeugen, mit gerade genug Frische, um die Leute zu kriegen. (…) Wenn es eine Referenz an eine bestimmte Epoche geben soll, dann an die fünfziger Jahre, denn deren Stil transzendiert die Jahrzehnte und erscheint bis heute modern.“
You’re my best friend, but then you died, when I was 23 and you were 25. You’re my best friend, but then you died, and how will I survive, survive, survive, survive? And every day, I waited for you, and every day, on the top of your car.
„Eigentlich sollte das die schönste Zeit meines Lebens sein“, fängt Jonathan den Satz an, und wenn man nicht schon von zu vielen Musikern angelogen worden wäre in seinem Berufsleben, oder nennen wir es angeflunkert: Man würde jetzt nicht überlegen, ob die Melodramatik nicht vielleicht zu seinem Act gehört. Außerdem kann Jonathan auch ziemlich gut sarkastisch sein, das hat man schnell raus.
Bevor Jonathan weiterredet, nippt er erst mal an dem Glas australischen Sauvignon Blanc, von dem Adam zwei Flaschen aus der Küche des „Empress Ballroom“ rausgeschmuggelt hat, jedenfalls lagen die nicht in dem Waschzuber mit Becks- und Cola-Flaschen und mittlerweile pisswarmem Eiswasser, den der Veranstalter vorm Auftritt hier hineingestellt hat. Die Band hat sich vom großen Backstage-Raum in ihre kleine Garderobe zurückgezogen.
Der Raum ist vielleicht vier mal zwei Meter groß, fensterlos, weiße Wände, dunkler Teppichboden, hinten in der Ecke ein Schminktisch, an den Längsseiten des Raumes jeweils eine Tischreihe, darauf der Getränkewaschzuber, eine Megapackung Mars-Miniriegel, eine Megapackung Chips-Minitüten. Übers Macbook läuft eine Mix-CD, die Connor aus Langeweile am freien Tag gebrannt hat, viel Smiths, viel Postpunk. Es stinkt unfassbar nach Schweiß, aber das vergisst man nach ein paar Minuten. Man hätte nicht gedacht, dass die Drums stinken können.
Adam, der vielleicht Hübschste, jedenfalls Stillste, hält die halbvolle Flasche Sauvignon Blanc und redet mit Sean, dem Tourmanager, über den Geschmacksunterschied zwischen kaltem und lauwarmen Sake; Jacob, der am Ende wohl Straighteste, unverstellt Ehrgeizigste, steht mit drei Jungs zusammen, keine Ahnung, wer die sind und worüber die Vier jetzt reden; Connor ist gerade noch mal raus, rauchen; und hier, hier, hier: Jonathan, der Sänger. Obwohl er auf den ersten Blick etwas kantig und ungelenk wirkt, blond, groß, harte Gesichtszüge, ist in seinem Blick etwas seltsam Zartes, Verletzliches, Verlorenes. Ein idealer Frontmann: Jeder kann sich ein Geheimnis in ihn hineindenken, und ob es am Ende wirklich eines gibt, ist gar nicht entscheidend. Die Illusion zählt.
Jonathan setzt noch mal an: „Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Gestern habe ich mich dann nach dem Frühstück hingesetzt und einen Text geschrieben. Als ich fertig war, und das geht bei mir immer schnell, ich finde ja überhaupt, was nicht schnell gesagt ist und sich schnell aufschreibt, ist keinen Song wert… Also, als ich fertig war und mir den Text noch mal durchgelesen habe, da war das der deprimierendste, den ich je verfasst habe. Überhaupt kommen in letzter Zeit nur noch traurige Texte raus. Ich steh vorm Spiegel, schau mich an und denke: Mann, du lebst gerade deinen Traum, wir sind so kurz davor, wirklich so kurz, und dir, dir geht nur noch Scheiße durch den Kopf. Du fängst plötzlich an zu grübeln. Ich frag mich langsam ernsthaft: Werde ich je wieder einen fröhlichen Song schreiben?“
Vielleicht ist das der Tribut den man ans Jungsein zahlt, wenn man sich mit nichts anderem befasst als dem Jungsein. Vielleicht ist das die erste Ernüchterung, wenn man das Jungsein Abend für Abend wiederaufführt. Sehnsucht und Versprechen nicht eingelöst werden, nicht eingelöst werden können. Vielleicht entliebt sich Jonathan gerade vom Jungsein. Vielleicht ist es auch eine späte Form von teenage angst.
Dann trinkt Jonathan das Glas leer und verabschiedet sich, er sei müde, es ist kurz nach zehn. Die anderen bekommen es erst gar nicht mit und trinken noch ein bisschen weiter, bis elf, dann packen sie die übrig gebliebenen Flaschen Becks aus dem Waschzuber in einen Pappkarton und schultern ihre Taschen. Jacob, Adam und Connor gehen durch die Hintertür ins Freie, Sean, der Tour-Manager, trägt den Pappkarton mit dem Restbier. Es ist ein kühler Abend, draußen wartet niemand.
Am nächsten Morgen soll es um zehn Uhr weitergehen, Wolverhampton ist die nächste Station, zwei Shows, danach geht es nach London, drei Shows, danach heim nach New York City. Jonathan, der Einzige, der eine Wohnung hatte dort, hat sie aufgelöst, bevor sie im Februar losgezogen sind. Er hat sogar seinen Hund weggeben.
Um elf Uhr am nächsten Morgen geht es weiter: Nieselregen zieht von der Irischen See herein, direkt vorm Hotel führt die Uferpromenade entlang, es gibt keinen Strand in Blackpool, von dem man seine Liebe hochtragen kann, all the way home, aber es gibt Meerblick, jede Menge Meerblick.
We, we are in love. And we – forever. We’re not gonna stop. We’ll be forever. And all the stars in the sky, and all the flowers in the fields, and all the flowers in the earth. Could never take you from my heart. And it’s forever, baby, it’s forever.
Albumkritik ME 6/10
www.thedrums.com