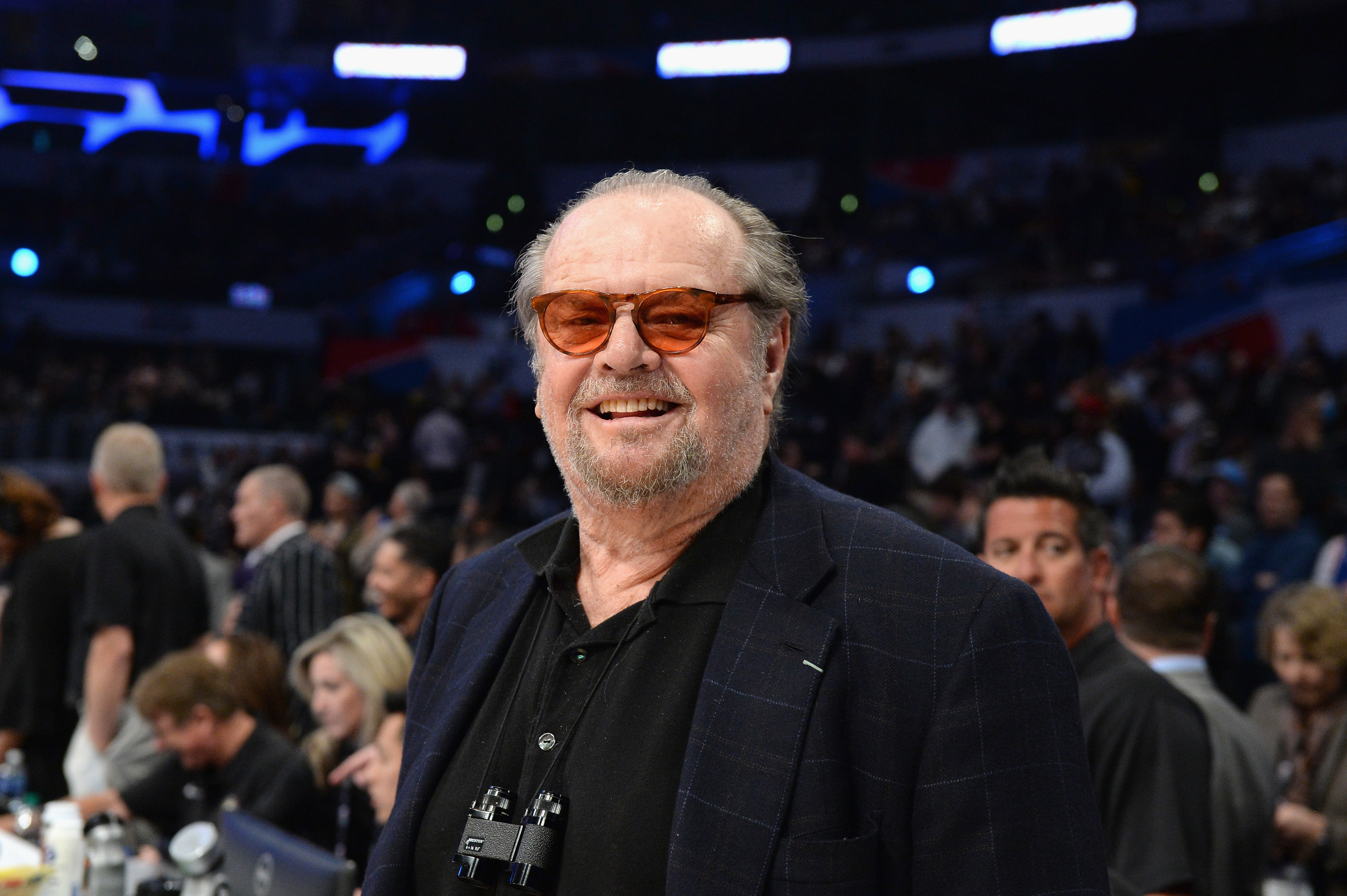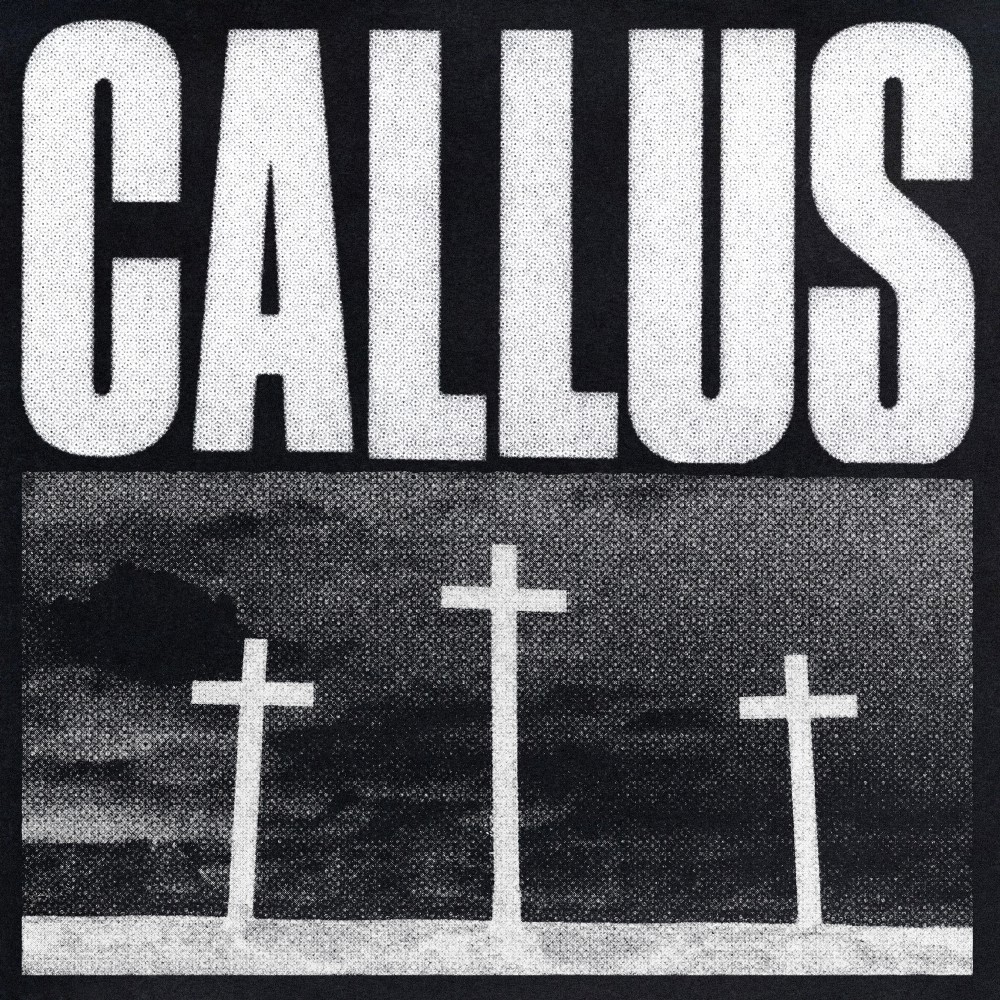Gonjasufi
Callus
Warp/Rough Trade
Nichts für schwache Nerven! Für sein drittes Album nimmt der psychedelische Trip-Beat-Driftmeister Kontakt zum Weltuntergang auf.

Von Gonjasufi hatte man schon länger wieder etwas erwartet. Vielleicht nichts in dem Ausmaß, das man mittlerweile von anderen Vertretern des neuen kalifornischen Experimental-Pop wie Großmeister Flying Lotus gewohnt ist. Etwas mehr als seine bisherigen Alben A Sufi And A Killer (2010) und MU.ZZ.LE (2012) durfte es aber schon sein. Starke Verbindungen zu den psychedelischen 60ern, eine Neigung zu Abenteuern in indischer Musik, die außerweltliche Atmosphäre, die sein Werk trägt, Überraschungen wie der Funk von „Candylane“ aus seinem Debüt oder der gelegentlich wilde Sturm des Garagenrock hatten Sumach Ecks alias Gonjasufi zu einer vielversprechenden Figur dieses Jahrzehnts gemacht.

Von dieser Erwartungshaltung hat der Mann auch etwas bemerkt. Den Opener seines dritten Albums CALLUS, „Your Maker“, beginnt er mit gesampeltem Publikumsapplaus. Der Bass kommt tief und düster daher und Gonjasufi wirkt abwesend von diesem Planeten, fast verzweifelt. Er hat wirklich keine Probleme damit, den nervös wartenden Fans jetzt ein ganz finsteres Stück vorzuwerfen, an dem sie erst mal zu knabbern haben. Das Wort „callus“ übersetzen wir als Hornhaut oder Schwiele. Angesichts dieses Albums besteht kein Zweifel daran, dass sich dieser urige Geselle diese Erscheinungen überall am Körper und gerade auch in der Seele vorstellen kann. „Wie kann man diesen Schmerz nicht spüren?“ fragt er in einer Presseerklärung. Es gehe „nicht darum, etwas hinter sich zu lassen, sondern in etwas hineinzuwachsen. Ich bin durch all diese Schichten gedrungen, um zum Kern vorzustoßen.“
Nicht immer lässt er uns lange an seinen Erkenntnissen teilhaben. In „Maniac Depressant“ stampft er durch den Sumpf des verlorenen Wohlbefindens und leider hört er schon nach knapp zwei Minuten wieder auf. Wenn die Songs länger wären, könnte Gonjasufi sich und die Hörer so richtig durch das Tal des Elends ziehen. Aber immerhin macht er vor irdischen Grenzen nicht Halt. In „Afrikan Spaceship“ gibt er sich abgehoben. Einerseits zitiert er Sound und Quengelstimme von Jack White, andererseits will er den Ausflug mit einem spacigen Verkehrsmittel aus dem Jenseits vollziehen. Jack White? Ja, solche Querverweise gibt es durchaus. In „One Man Sufferah“ hat man den Eindruck, als wohne man Robert Wyatt bei einer Dub-Erforschung bei. Ein echter Schlüsseltrack des Albums ist „Poltergeist“. Geigen gliedern sich ein und die Gitarre bohrt punktuell auch mit, aber entscheidend ist, dass die Stimme wie die von Mark E. Smith nörgelt. Nie geht es zu sehr ins Extrem, aber man spürt dass der Künstler ungehalten ist. Was das wohl hervorgerufen hat zu diesem Zeitpunkt? Terrorismus, rassistisch motivierte Polizeigewalt, ein alberner und gefährlicher Präsidentschaftswahlkampf in den USA? In der Paraderolle des Poltergeists ist Gonjasufi ein Mann mit Unruhepotenzial, der im Untergrund Schwierigkeiten entdeckt und fördert. Es ist ihm nur recht, dass es so läuft. „I don’t want to hear about a better way“, bekennt er in „Shakin Parasites“ über die Dauer von für dieses Album stattlichen sechseinhalb Minuten. Wieder fühlt man sich wegen der gequälten Stimme an The Fall erinnert, der bissige Beat im Hintergrund hilft dabei.
In seiner Gesamtheit ist dieses Album schon ein schwer begreifbares Problempaket, mit dem man sich näher beschäftigen muss. Der Musiker hat noch nicht mal im alternativen Sinn eine Hit-Single abgeliefert. Er arbeitet lieber mit Andeutungen, die sich zu einer gigantischen gedrückten Stimmung verdichten. Für seinen variantenreichen Nervenkitzel müssen wir dem Callus Maximus aber sehr dankbar sein. Da hat ihn schon richtig etwas gepackt.