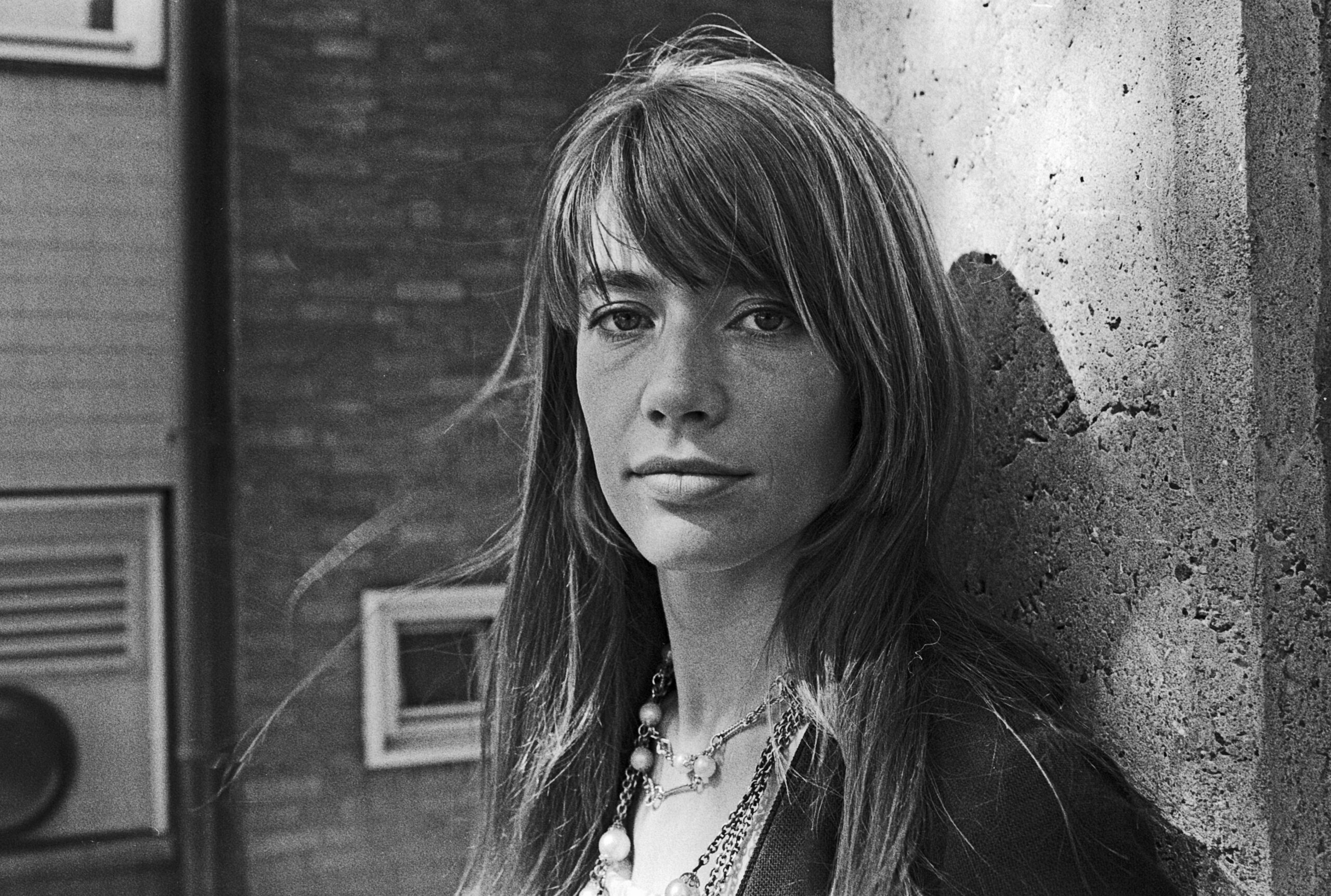Nachruf auf Aretha Franklin: Weit mehr als die „Queen of Soul“
Ohne sie wären die Karrieren von Whitney Houston, Amy Winehouse oder Beyoncé undenkbar gewesen: Jetzt ist Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Einfluss der „Queen of Soul“ geht weit über die Musik hinaus.

Im Dezember 2015 wurde noch einmal die ganze Welt Zeuge, was für eine Naturgewalt diese Frau war. Es trug sich zu in Washington D.C., wo im Kennedy-Center unter anderem der „Star Wars“-Schöpfer George Lucas, der Dirigent Seiji Ozawa und die Songwriterin Carole King geehrt werden sollten. Doch nach der Gala sprach man nur noch von ihr: Aretha Franklin, die im dicken Pelzmantel auf die Bühne gekommen war, um Kings Klassiker „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ zu interpretieren. Zunächst am Klavier mit weich modulierender Stimme und hartem Anschlag, dann, nachdem sie den Mantel lässig von sich geworfen hatte, in der Bühnenmitte stehend und die irrwitzigsten hohen Töne vom Himmel holend, wie nur sie das konnte.
Ein Triumph. US-Präsident Barack Obama strich sich in der Loge eine Träne aus dem Auge und sang gemeinsam mit seiner Gattin ergriffen den Kehrreim mit; Carole King, die medaillengeschmückte Komponistin, rastete auf ihrem Platz aus wie eine Teenagerin. Was für eine Frau!
Schon als Kind ein Talent von Welt

Einen ähnlich furiosen Eindruck muss Aretha Franklin auch schon 1967 bei den Hörern hinterlassen haben, als ihr erster Riesenhit und lebenslange Erkennungsnummer die Charts stürmte. Als größtes Sangestalent seit Billie Holiday hatte die 1942 in Memphis, Tennessee geborene Tochter des berühmten Baptistenpredigers C.L. Franklin schon seit Mädchentagen gegolten. Nur hatten die Plattenfirmen den Fehler gemacht, die mutterlos in Detroit aufgewachsene Jahrhundertbegabung zuckersüß-harmlosen Pop singen zu lassen. Erst mit dem Wechsel zum auf schwarze Musik spezialisierten Label Atlantic Records blühte Aretha Franklin auf. Getauft in den Wassern des Gospels und inspiriert von Martin Luther King, der im Haushalt ihres Vaters ein- und ausgegangen war wie auch Mahalia Jackson oder Sam Cooke, sang sie selbstbewusst fauchend davon, was der weibliche und der afroamerikanische Teil der USA gerade am nötigsten brauchte: Kein Mitleid, keine faulen Ausreden. Respekt.
„Think“ wäre da zu nennen, diese Abrechnung mit einem gedankenlosen und manipulativen Gegenüber, aus der 1980 im Kultfilm „Blues Brothers“ eine gewitzte feministische Musicaleinlage wurde, und dessen „Freedom“-Rufe erhebender, aufrüttelnder und bezwingender wirken als jede Hashtag-Diskussion heutzutage. Oder die gemeinsam mit Annie Lennox vorgetragene Kampfansage „Sisters Are Doin‘ It For Themselves“, mit der Franklin Mitte der 1980er wieder an alte Erfolge anknüpfen konnte. Zwischendurch war sie mit der erhebenden Gospel-Platte „Amazing Grace“ zu ihren Wurzeln in der Baptistenkirche zurückgekehrt.
Beyoncé wäre ohne Franklin nicht denkbar

Es ist höchst bedauerlich, dass man die unter starker Flugangst leidende Sängerin nach 1983 nicht mehr auf einer europäischen Bühne erleben konnte. Mit der kratzbürstigen Diva, die sie 2010 in einem Werbespot für einen Schokoriegel im deutschen Fernsehen verkörperte, hatte sie musikalisch nie etwas gemein. „You need me/And I need you / Without each other there ain’t nothing people can do“, sang sie in „Think“. Wir brauchen alle einander. Das war Franklins Credo, das sie gleichzeitig energisch und gefühlvoll vortrug, mit kleinen Schleifen und atemberaubenden Loopings, ohne dass ihre Impromptus je zu einer sportlichen Übung verkommen wären – wie bei vielen ihrer Nachfolgerinnen.
–
Dieser Text erschien zuerst bei den Kollegen von Welt.de