Modecodes Teil 2: Verschwende deine Jugend
Während man früher die Jugend- und Subkulturen ziemlich einfach an ihrer Kleidung und ihren Accessoires erkennen konnte, ist es heute um einiges schwieriger.

Jugendkulturen. Gibt es sowas noch? Während man früher die Jugend- und Subkulturen ziemlich einfach an ihrer Kleidung und ihren Accessoires erkennen konnte, ist es heute um einiges schwieriger. In modischer Hinsicht ist es ein bisschen so, als ob es parallele, nebeneinander existierende Jugendkulturen nicht mehr gäbe, sondern sich deren Nebeneinander und Facettenreichtum im Kleidungstil ein und derselben Person manifestieren können. Da treffen dann Totenkopfringe auf Parkas, Doc Martens auf Baggy Pants, oder Poloshirts auf Skateboards. Diese Kombinationen sind so alt nicht. Wo diese Modecodes herkommen untersuchten wir bereits im ersten Teil unseres Zweiteilers „Verschwende deine Jugend“. Hier nun der Zweite.

HipHop? Hurra! Kein Musikgenre repräsentiert so gerne wie Rap. Wen wundert, dass sich das auch optisch bemerkbar macht
Zwei Dinge gibt es, über die wir reden müssen, wenn wir über HipHop-Mode sprechen. Einmal die Baggy Pant. Dass die ihren Ursprung in den amerikanischen Gefängnissen hat, wo Häftlingen der Gürtel abgenommen wurde, damit sie sich nicht erhängen können, ist eher These als Fakt. Was jedoch eine Konstante im Game ist, ist die Liebe zur Marke als Distinktionsmittel. Run D.M.C. setzten 1986 mit „My Adidas“ dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach ein Denkmal, zahllose Rapper arbeiteten nach ähnlichem Wirkprinzip, wobei sich die besungenen Marken mit den Jahren verändert haben. Heute wird nicht mehr nur über Streetstyle, sondern auch über Prada, Gucci, Hermès und Vivienne Westwood gerappt, bevorzugtes Accessoire ist seit Anfang der 90er-Jahre das Starter Cap. Ansonsten ändern sich die Verästelungen der Mode im Saison-Takt, was auch daran liegt, dass viele Größen des Genres eigene Fashion-Label besitzen. Der beste HipHop-Look ist leider in Vergessenheit geraten: Conscious-Rap-Acts wie A Tribe Called Quest oder Arrested Development bezogen sich auch modisch auf ihre afrikanischen Wurzeln.
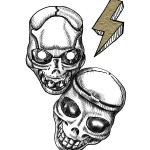
Härter, schneller, lauter — und meistens recht freundlich. Der Hype um das Wacken-Festival zeigt: Metal lebt
Historisch ist das womöglich nicht ganz akkurat, aber landläufig gelten die Kalifornier von Blue Cheer, die 1968 mit einer ruppigen Coverversion des Eddie-Cochran-Hits „Summertime Blues“ ihren größten Hit hatten, als die Erfinder des Heavy Metal. Es lässt sich also eine Ahnenlinie vom Hippie herstellen, die allerdings rasch an Kontur verlor, sowohl musikalisch als auch optisch. Die Musik wurde mit den Jahren, logisch: härter, schneller, lauter. Vor allem splittete sie sich in zahlreiche Untergenres auf. Der Look, den man heute landläufig mit Heavy Metal verbindet und der Dekaden lang auch die deutsche Provinz prägte, bezieht sich eher auf den britischen Metal der Spätsiebziger: Kutte, enge Jeans, schwarzes Bandshirt, lange Haare, die in den späten 80er-Jahren kunstvoll auftoupiert wurden: Bis auf Letzteres hat das alles seinen Weg in andere Kulturen gefunden. Bestes Beispiel ist der Berliner Rapper Romano, der mit seinem Song „Metallkutte“ im vergangenen Jahr dem wichtigsten Bekleidungsstück ein Denkmal setzte. Vor allem aber ist aus einer Jugendbewegung eine der größten der aktuellen Popkultur geworden: Von den Stones abgesehen haben die meisten Stadion-Rock-Bands mindestens ihre Wurzeln hier.

Die 90er waren gar nicht so schlimm. Dass die Jugendkultur des Ravers vorbei ist, macht aber nicht viel aus
Selten war eine Begrifflichkeit so diffus wie diese. Wir nehmen die wohl bekannteste Interpretation und beziehen uns auf den kommerziell wahnsinnig erfolgreichen, mit Eurodance flirtenden Rave der 90er-Jahre. Schlaghosen aus Polyester, Bauarbeiterwesten, Nylonrucksäcke mit Stacheln, abrasierte Haare. Ein wilder Look, der sich sowohl aus Sci-Fi-Filmen als auch der Fetisch-Szene speiste, das ganze mit der Ikonographie des Acid House sowie schlagerhafter Prilblumen-Optik mischte. Am Ende schwebte der Raver dank der Plateausohlen seiner Buffalo Boots fünf Zentimeter über dem ganzen Rest und blickte dabei durch Sonnenbrillen, die ihn wie eine Druffi-Version von „Puck, die Stubenfliege“ aussehen ließen. Natürliches Habitat des Ravers waren Großraumdiscos oder gleich die Love Parade. Die Keimzellen der Bewegung liegen natürlich in einem früheren Zeitalter — im Chicago und Detroit der 80er-Jahre, als aus Disco House und Techno wurde, in Manchester und auf der Feierinsel Ibiza. Heute ist elektronische Musik längst etablierter Teil der Popkultur. Die Leute auf Raves sehen eigentlich ganz normal aus. Plateauschuhe kommen trotzdem alle fünf bis zehn Jahre wieder, wenn auch eher auf dem Laufsteg als auf dem Pausenhof.

Der Rock’n’Roll Amerikas trifft Englands Vergangenheit — die Erwachsenen waren not amused
Auch wenn es heute noch Menschen in den Großstädten gibt, die den Look der 50er- Jahre fahren und sich vielleicht als Rockabillys verstehen — klassische Teds sind aus dem Straßenbild völlig verschwunden. Vielleicht, weil es doch eine sehr abgezirkelte Jugendbewegung war. Wo der Begriff später allgemein auf Rock’n’Roll-Fans mit Fifties-Vorlieben und ensprechendem Look (Tolle! College-Jacke! Eben der Stil, den später der Film „Grease“ nacherzählte) angewandt wurde, bedeutete er eigentlich etwas anderes. Die Musiker, die Schauspieler, die die ursprünglichen Teddyboys liebten, waren Amerikaner: Elvis Presley, James Dean, Bill Haley, Marlon Brando — das waren nicht die Role Models, mit denen die Elterngeneration konform ging. In England korrespondierten die amerikanischen Helden mit einem ganz eigenen Look, der anfangs exklusiv unter diesen Begriff fiel: Wildlederschuhe mit Kreppsohlen, Gehröcke, die sich an der edwardianischen Zeit orientierten, viele Farben, dazu eben die Insignien des amerikanischen Rock’n’Roll der 50er-Jahre: all das machte den Ted aus. Sogar der „Spiegel“ widmete dem Phänomen 1956 einen Artikel unter dem Schlagwort „Die Arbeiter- Dandys“.

Das Skateboard ist nicht nur wichtiger als Deutschland, sondern auch Gestaltungsmittel im urbanen Raum
Ganz klar ist der Ursprung des Skateboardings nicht — so sollen schon im Frankreich der 40er-Jahre Kinder mit selbstgebauten Rollbrettern gespielt haben. Wahrscheinlicher ist folgende Theorie: In den 50er-Jahren suchten die Surfer Kaliforniens nach Ersatzbeschäftigungen für Flautetage. So entstand das sogenannte „Sidewalk Surfin’“. Daraus entwickelte sich das Skateboard, eine Industrie, letztendlich eine ganze Kultur, die früh ihre eigenen Magazine, ihre eigenen Filme, ihre eigenen Brands hatte und bis heute die Städte prägt. Die Skater sind neben dem Sprayer die vielleicht wichtigste Jugendkultur im urbanen Raum — weil sie die Stadt mit einem eigenen Auge erschließen, weil sie Strukturen nutzen, die an sich anders genutzt werden sollen und so selbst neu kontextualisieren: Im Prinzip schaffen sie ihre eigene Benutzeroberfläche. Die Mode musste zunächst nur zwei Kriterien erfüllen: Sie sollte bequem und widerstandsfähig sein. So ist wohl zu erklären, dass in den 90er-Jahren Workwear-Marken wie Dickies zur festen Ausstattung der Skater gehörten; die Firma selbst war sich der Verarbeitung ihrer Hosen so sicher, dass sie den Kaufpreis erstattete, wenn eine Hose riss. Der Baggy-Look der 90er-Jahre ist übrigens nicht skate-immanent. Im Gegenteil, mit weiten Hosen lässt sich schlecht fahren.

Gepflegtes Nichtstun im Karohemd: Die nach einem Richard-Linklater-Film benannten Slacker machten wenig bis null
Heute geht das gar nicht mehr, aber in den frühen 90er-Jahren war es überhaupt kein Problem, sich mit 20 DM auf dem Flohmarkt feudal einzukleiden. Lederjacken, Adidas-Trainingsjacken, Cordhosen, Karohemden: Was dieser Tage mondmäßig ausgepreist in der Vintage-Ecke von American Apparel und Co. hängt, war früher – nunja, halt alt und billig. In den USA gab es riesige Thrift Stores der Heilsarmee, in denen man die Kleidung gleich kiloweise kaufen konnte. Bands der Zeit wie Pavement, Superchunk oder in Deutschland Tocotronic und ihre Fans fuhren diesen Look an der Schnittstelle zwischen Punk (zerrissen!), Hippie (alt!) und dem Zeug, das dein Vater so trug. Neben dem auch Grunge-mäßig konontierten Karohemd lag der Fokus des geschmackvollen Slackers lange Zeit auf Shirts mit Firmenaufdrucken, Truckermützen von Futtermittelherstellern — den Trend eigneten sich später unangenehme Zeitgenossen an — und Band-Anstecknadeln. Der Slacker machte aber nicht nur Musik, er slackte auch ordentlich rum. Bedeutet: lange schlafen, abhängen, ab und an ein Bier. Generation X halt, kennt man ja aus Filmen wie „Singles“ oder „Reality Bites“. Der erste Slacker der Geschichte ist Martin, Protagonist des sehr guten 50er-Jahre-Films „Zur Sache Schätzchen“.








