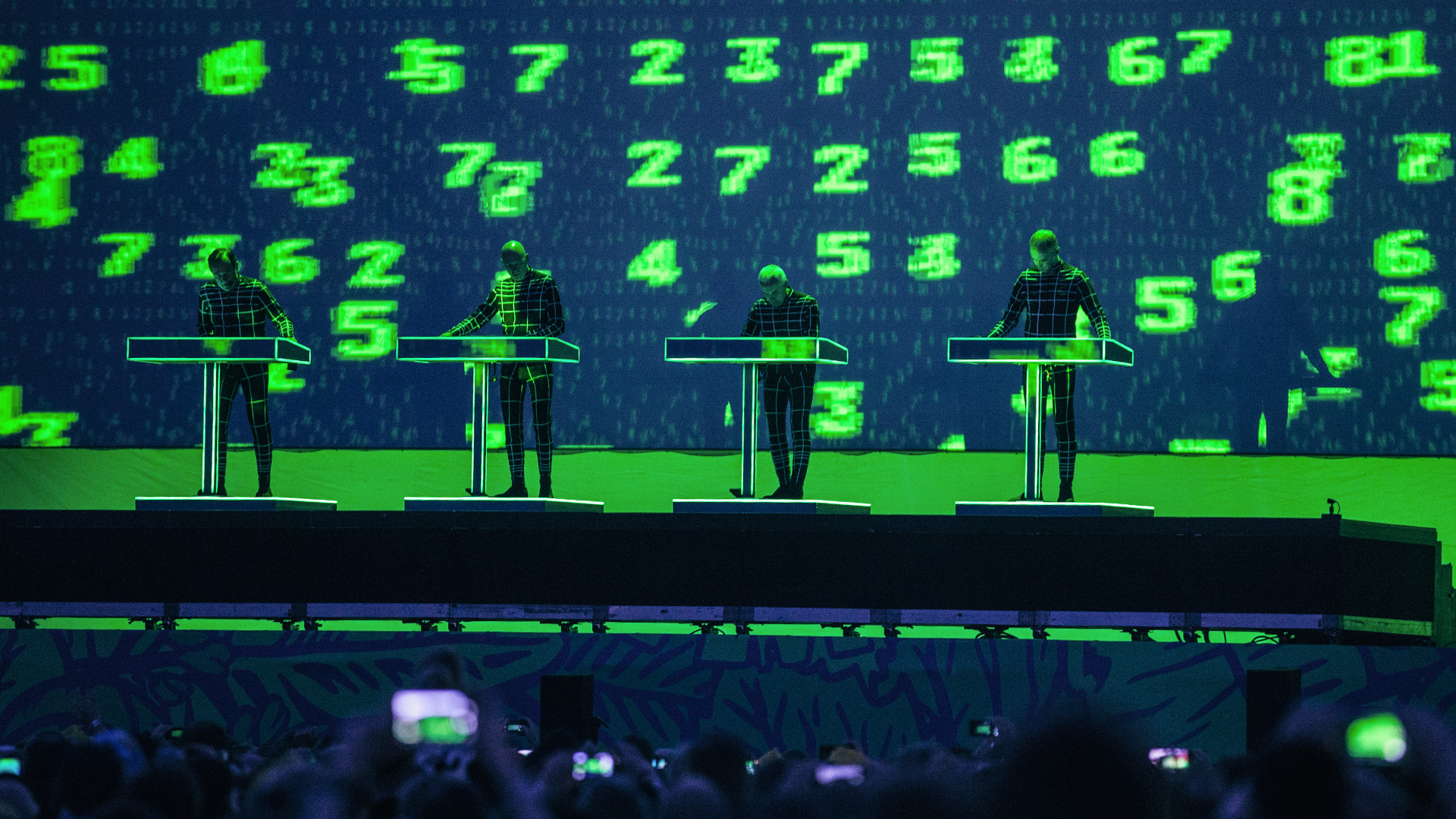„Little Fires Everywhere“ auf Amazon Prime: Zwischenmenschlich aufregend
Die neue Drama-Serie erinnert mit ihren Lügen und Geheimnissen nicht nur an „Big Little Lies“, sie ist auch ein Home Run für Reese Witherspoon. Aber mit dem 90er-Jahre-Vibe, der differenzierten Auseinandersetzung mit Vorstadt-Rassismus und den Geschlechter-Klischees können die acht auf einem Roman basierenden Folgen noch viel mehr.

Vorstadt-Idylle, Familienzwiste und 1990er-Jahre-Ästhetik: Trotz des hochkarätigen Casts mit Reese Witherspoon, Kerry Washington und Joshua Jackson scheint die achtteilige Serie „Little Fires Everywhere“ erst mal nur alte Standards aufwärmen zu wollen. Doch innerhalb der schmal gesteckten Grenzen entwickelt sich schnell eine psychologische Komplexität, die die Zuschauer*innen mitreißt. Hier sind noch fünf weitere Gründe und einige Spoiler, die diese Mini-Serie abfeiern und zum Pflichtprogramm erklären.
https://www.youtube.com/watch?v=JWGkX8ClhBI&t=27s
Erstens: Das Pferd von hinten aufgezäumt
Direkt am Anfang steht Mutter, Vorstadt-Despotin und Journalistin Elena Richardson (Reese Witherspoon) vor den kokelnden Überresten ihrer monströsen Oberschichten-Villa. Die Feuerwehr vermutet Brandstiftung, viele kleine Feuer hätten sich zu einem großen Brand entwickelt – und die Whodunit-Geschichte liegt zum Greifen nahe. Dass dieses Feuer viel mehr bedeutet, als das Ende eines Zuhauses für Elena, ihre vier pubertierenden Kinder und ihren Mann Bill (Joshua Jackson), stellt sich erst ganz am Ende heraus. Vorher wird ein Jahr zurückgesprungen – und auch zwischendrin wechselt man noch öfter die zeitliche Erzählperspektive. Um die trügerische Vorstadt-Idylle, die durch das Erscheinen der Künstlerin Mia Warren (Kerry Washington) und ihrer Tochter Pearl (Lexi Underwood) unfreiwillig auf den Kopf gestellt wird, spannt sich schnell ein Netz aus Lügen, Geheimnissen und Vorurteilen, die Elenas Bilderbuchleben zu zerstören drohen. Eine sehr amerikanische Drama-Soap, die allerdings schnell über sich hinauswächst und durch komplexes Storytelling beweist, dass scheinbar ausgefranste Geschichten mit dem richtigen Betrachtungswinkel immer noch ziemlich gut funktionieren können.
Zweitens: Eine Witherspoon-Produktion
Als Romanvorlage diente das gleichnamige Buch (auf Deutsch: „Kleine Feuer überall“) von Celeste Ng, das 2017 in den USA 48 Wochen in der Bestsellerliste der New York Times stand und an dem sich Reese Witherspoon mit ihrer Produktionsfirma „Hello Sunshine“ schon früh die Filmrechte sicherte. Nach der HBO-Serie „Big Little Lies“ (seit 2017) und „The Morning Show” (seit 2019) auf Apple TV+ schafft es die Schauspielerin nun auch auf Amazon Prime Video als Serienmacherin in die Welt der Streaming-Unterhaltung. Zuvor war sie übrigens mit ihrer alten Produktionsfirma „Type A Films“ an Filmen wie „Natürlich blond 2“ (2003) oder „Penelope“ (2006) als Produzentin beteiligt. Die vorschnell als eindimensionale, ewig oberflächliche Blondine aus „Pleasantville“ (1998) oder „Natürlich blond“ (2001) abgeheftete Witherspoon hat es aber spätestens als June Carter Cash in „Walk The Line“ (2005) zu gebührender Anerkennung als Darstellerin geschafft, inklusive Oscar als Beste Hauptdarstellerin. Und dennoch ist sie in der Rolle der oberflächlichen, herrschsüchtigen Blondine gleichzeitig doch wieder die perfekte Besetzung für eine der Hauptfiguren dieser neuen Serie. Nebenbei bemerkt war sie – ebenso wie Buch- und Co-Autorin Ng – Studentin an einer Elite-Uni (Literatur in Stanford für Witherspoon, Englisch in Harvard für Ng) – eine schmucke Vorkenntnis, die ihr bei dieser Serie sicherlich geholfen hat.
Drittens: Kulturelle Aneignung
Gutmenschlichkeit als Dämpfer für das schlechte Gewissen in einem privilegierten Umfeld: Elena kümmert sich beständig lieber um Mia, der sie erst eine Wohnung und dann einen Job vermittelt, als um ihre jüngste Tochter Izzy (Megan Stott). Doch gut gemeint, ist da noch lange nicht gut gemacht. Und obwohl Mia ihrer als vermeintlich mittellose Künstlerin mit dunkler Hautfarbe bewusst ist wie ihrer Definition von feministischer Selbstbestimmtheit, hat sie längst Zutritt zur weißen Oberschichtenwelt der Richardsons erlangt. Ganz im Gegensatz zu Bebe Chow (Huang Lu), die Mia bei ihrem Nebenjob als Kellnerin in einem Restaurant kennenlernt. Chow lebt als Chinesin illegal in den USA und hat ihr Baby, aus Geldnot und Panik schon kurz nach der Geburt an einer Feuerwehrwache zurückgelassen. Kulturelle Klischees dienen hier als Startpunkt, die Verknüpfungen und Emotionen, die sie aufwerfen, reichen deutlich tiefer. Und auch die Dialoge bringen Spannung und Erkenntnis in die klaffenden Lücken zwischen Stereotypen und Realität. Die Vermengung von überzogener Schulball-Affektiertheit und künstlerischer Abstraktion beim Fahrrad-Recycling funktioniert auch deshalb so gut, weil die Aneignung von fremden Kulturen, inklusive ihrer Rituale, ihrer Sprache und ihrer Mode nur solange oberflächlich bleibt, bis jemand die wahren Beweggründe hinterfragt. Das geschieht in „Little Fires Everywhere“ glücklicherweise häufig. Doch am Ende gewinnen sie immer, „die Reichen, die Schönen und die Beliebten, die denken, sie dürfen alles und scheißen auf alles was andere wollen“, fasst es Richardsons Sohn Moody (Gavin Lewis) einmal lakonisch zusammen.
Viertens: Brennt das noch, oder kann das weg?
Gegensätze können auch dort entstehen, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Hier sind die amerikanischen Serienklischees wie das Verlieren der Jungfräulichkeit auf dem Schulball, oder die Frage, ob man Menschen mit dunkler Hautfarbe nun „blacks“ oder „african americans“ nennen muss genauso zuhause, wie der Restaurantbesitzer, der unter der Ladentheke Koks verkauft, oder die Kindergeburtstagsparty, die bei den geladenen Männern wegen einer parallel angeschauten TV-Sportübertragung eher unter „ferner liefen“ rangiert. Es wäre zu einfach den Drehbuchautor*innen um Showrunnerin Liz Tigelaar („Revenge“, „Nashville“) und Serien-Co-Autorin Ng schlichte Ideenlosigkeit vorzuwerfen. Denn die USA leben und streben vor allem nach dieser höchst widersprüchlichen Oberflächlichkeit und Perfektion. „Little Fires Everywhere“ holt aus dieser alten Kamelle aber noch einmal alles raus. Es geht nicht ausschließlich um Rassismus, nicht nur um die Rolle der Mutter, nicht um Geschlechterkämpfe oder Gehaltsdifferenzen, nicht nur um die Selbstfindung während der Pubertät, sondern um die komplexe Interaktion, die aus all diesen Bestandteilen erwächst – und die manchmal äußerst schwierig zu durchschauen ist.
Fünftens: Musik und Analogfotografie
Die 1990er hatten noch andere Selbstverständlichkeiten, die heute schön nostalgisch verklärt, oder ganz schön umständlich wirken können. Musik aus dem Walkman und Fotografie waren im Pre-Smartphone-Zeitalter eben noch nicht zu einer einzigen Wollmilchsau verschmolzen. Während das Hantieren mit der analogen Spiegelreflexkamera großen Raum in Mias künstlerischer Arbeit einnimmt, und Fotoabzüge somit als stilistisches Element in der Serie ihren ästhetisch-wertvollen Platz finden, ist die verwendete Musik heute vielleicht noch etwas besser greifbar. Hits des Jahrzehnts finden als neue Klavier-Interpretation ihren Platz: The Cures „Pictures Of You“ (1989, hier in der Version von Lauren Ruth Ward), Meredith Brooks‘ „Bitch“ (1997, gecovert von Ruby Amanfu) und Alanis Morissettes „Uninvited“ (1998, gecovert von Bellsaint) wecken für ältere Zuschauer*innen Ohrwurm-Erinnerungen, wirken aber in der Überarbeitung deutlich dramatischer und weniger fröhlich – ein weiterer geschickter Kniff, um die 90er und die melancholische Stimmung dieser überaus gelungenen Serie souverän zusammenzuführen.
Staffel 1 von „Little Fires Everywhere“ (8 Folgen, jeweils ca. eine Stunde Laufzeit) ist am 22. Mai 2020 bei Amazon Prime Video gestartet.