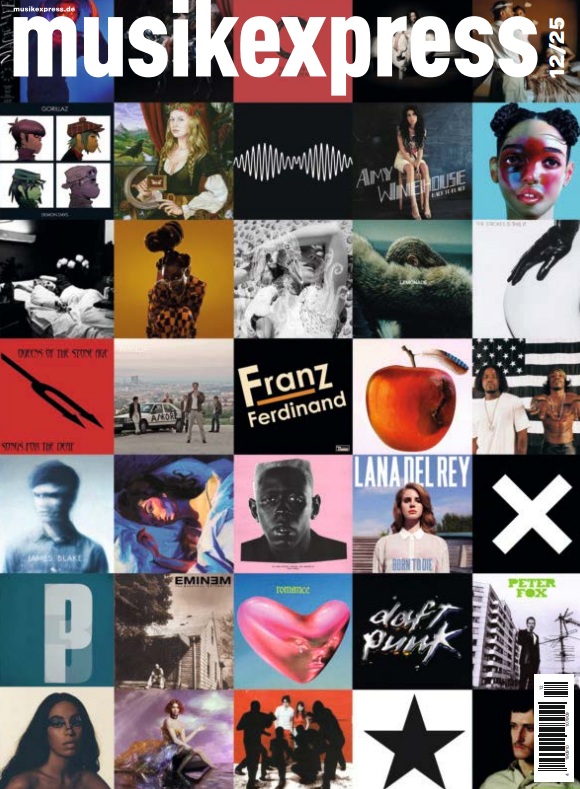„Lindenberg! Mach dein Ding!“ im Kino: Klischee-Aneinanderreihung mit Ensemble-Charme

Nicht etwa die Inszenierung rettet dieses Biopic über Udo-Labertasche-Lindenberg, sondern die Besetzung, die mehr aus der Bilderbuchstoryline herauszuholen weiß.
In Schulnoten eine 1, aber nur für akkurates Abarbeiten: Das Biopic über den jungen Udo Lindenberg hat vor, alles zu halten, was Musikfilme immer so versprechen. Die schwierige familiäre Situation, aus der es sich herauszuboxen gilt, den Absturz, den krassen Drogentrip, die Ego-Nummer, etwas Sex und natürlich den hochemotionalen „A Star Is Born“-Moment. „Lindenberg! Mach dein Ding!“ möchte eigentlich einen Ausnahmemenschen präsentieren, setzt dafür aber über zwei Stunden und 15 Minuten lang Klischeebausteine zusammen.

Eine Geschichte, die zu oft auf diese Weise erzählt wurde
Es ist schon klar: Ein Film wie „Bohemian Rhapsody“ hat gezeigt, dass es möglich ist, Rockklischees in groben Cuts plus markigen Sprüchen aneinanderzureihen und damit sogar noch bei den Academy Awards gut dazustehen. Aber könnte der Anspruch nicht ein anderer sein? Etwas weniger vom Gehabten, mehr von dem, wofür auch Udo fucking Lindenberg bekannt ist? Halt mehr frei von der Leber weg und ungeradlinig zum Beispiel.
Stattdessen steigt Regisseurin Hermine Huntgeburth („Die weiße Massai“) mitten in Lindenbergs Kindheit ein, die stereotyp für Werke dieses Genres stehen könnte. 1946 wird er ins westfälische Gronau hineingeboren, da ist erst mal nicht so viel zu holen. Sein Vater ist ein depressiver Klempner mit Hang zu schönen Melodien und Sauftouren (gewohnt exzellent von Charly Hübner gespielt), die Mutter (zu wenig Screen Time für Julia Jentsch) eine devote, aber liebenswürdige Hausfrau. Alles weist darauf hin: Wer hier herkommt, lebt ein langes, unspektakuläres Leben und stirbt dann auch, fertig.
Doch Udo denkt ans Wegkommen und an eine Musikerkarriere. Also lernt er das Schlagzeugspiel, beginnt eine Kellnerlehre und schwingt dann über Umwege nach Libyen, um dort in einer Jazzband schwitzig hinter den Drums zu hängen. Zum ersten Mal wird er in dem fremden Land aufgefordert, sein Glück am Mikrofon zu versuchen. Sein zurückhaltender Gesang auf Englisch wird sogleich mit Buh-Rufen quittiert.
“Nach dem vermeintlichen Tief folgt wie in jeder Erfolgsstory jedoch der Phoenix-Moment. Quasi „jetzt erst recht, Leute“! Dank Talentscout Matheisen (Detlev Buck könnte hier auch Elvis-Imitator sein) soll Udo bald seine Chance haben. Er singt auf Deutsch und über das, was um ihn herum passiert. Da ein Hauptteil der Geschichte in den frühen 70ern spielt, dürfen psychedelische Trips, ein bisschen freie Liebe und das Kommunen-Feeling nicht zu kurz kommen. Wir bekommen zudem die Paula aus St. Pauli vorgestellt, die sich immer auszieht – „Als wir träumten“-Schauspielerin Ruby O. Fee gibt hier die Prostituierte, die ordentlich eins an der Waffel hat. Zum anderen lernen wir auch die angesagte Musikspelunke Onkel Pöl kennen, die für viele Bands und Künstler*innen der Ort des Durchbruchs wird. Diese Kneipe stellt sich auch für den Lindenberg, so wie wir ihn jetzt kennen, als elementar dar.
Es geht ins Phantasialand – also fast
Jan Bülow ist derjenige, der dem „Lindenberg“-Film einen natürlichen Fluss gibt. Der 23-Jährige, der bisher an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch seine Ausbildung gemacht und in Christian Alvarts „Dogs of Berlin“ und „Abgeschnitten“ vor die Kamera durfte, wirkt anfangs noch etwas zu bemüht in der Zeit zurückgebeamt. Aber schnell ist eine Gewöhnung an die Udo-typische Mimik und Gestik da, sodass er einem erlaubt, über die Filmschwächen hinwegzusehen. Seine crazy Erlebnisse in einem Hamburg, was dem Phantasialand gleicht, sind trotz fehlenden Innenansichten unterhaltend charmant.
Da braucht es eigentlich nicht mal den echten Promi-Udo, der am Ende auch mal für eine Szene vorbeischaut und ein Lied mit Sonnenbrille und Oberschnute intoniert. Der Bülow ist derjenige, der zum Grinsen bringt, wenn er bei der Band einen Promilletest macht. Der Gag daran: Nur mit Fahne darf an der Platte gearbeitet werden. Wie der Lindenberg das ganze Gesaufe aushält und wie er es packt, Dauergast im Hotel Atlantic zu sein, bleiben vage Andeutungen.
Fazit: Hermine Huntgeburth will nicht den Star, der Lindenberg nun ist, entmystifizieren. Sie möchte aber schon erzählen, wie er sich so zusammengeformt hat. Dieser Ansatz ist legitim, ergibt nur eine beliebige Filmstory, die schon x-mal abgespult erscheint. Benjamin von Stuckrad-Barres Udo-Lindenberg-Version aus „Panikherz“ (2016) wäre aber beispielsweise eine gewesen, die mehr Reibungsfläche geboten und dem Super-Cast noch besser als diese Durchschnitts-Musikfilmvariante gestanden hätte.
„Lindenberg! Mach dein Ding!“ ist ab dem 16. Januar 2020 im Kino zu sehen.