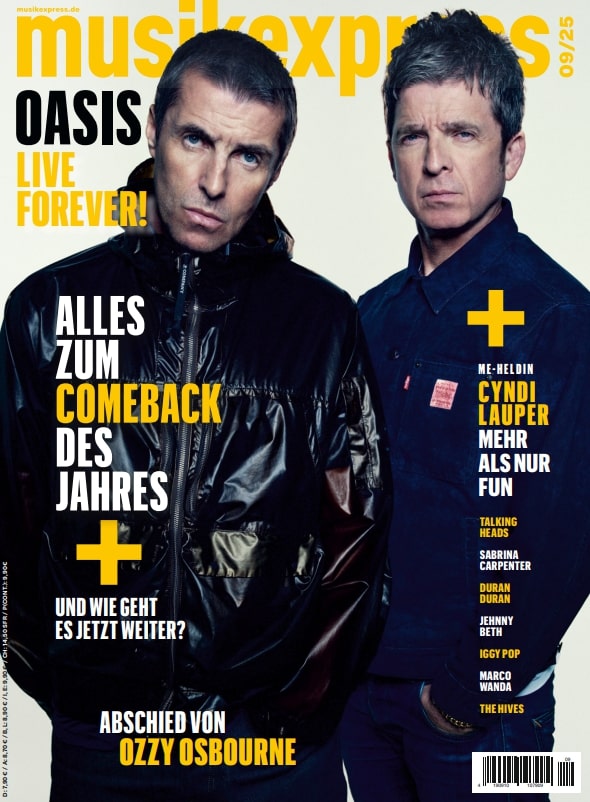10 Jahre „Breaking Bad“: Shakespeare auf Meth

Am 20. Januar 2008 lief in den USA die allererste Folge der Meth-Saga um Walter White. Wer die Serie bis heute ignoriert, begeht einen schweren Fehler.
Allein für die Idee, dass der Protagonist des wohl spannendsten Thrillers der Fernsehgeschichte ein Krebskranker ist, hat „Breaking Bad“-Erfinder Vince Gilligan den Preisregen aus Emmys und Golden Globes verdient. Es ist sein Meisterstück. Und Bryan Cranston spielt die Rolle seines Lebens: Den Chemielehrer Walter White, dieser Egomane Shakespeare’schen Ausmaßes, den man anfangs bemitleidet, dann bewundert und am Ende hasst – auch das eine Leistung, die vor ihm keine Serienfigur in dieser Form vollbracht hat. Als bei White ein bösartiger Knoten in der Lunge gefunden wird, ist die Diagnose niederschmetternd.

Den Tod vor Augen beschließt er, wenigstens noch seine Familie finanziell abzusichern, und steigt kurzerhand ins Drogengeschäft ein. Mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman (Aaron Paul) will er Crystal Meth „kochen“. In einem Wohnwagen machen sie in der Wüste New Mexicos erste Experimente, bis es White schließlich gelingt, Methamphetamin von größtmöglichem Reinheitsgehalt herzustellen, was sich in Albuquerque schnell herumspricht. Der Aberwitz, mit dem sie als Kleinganoven dilettieren, ist nicht zu überbieten. Schon bald geraten sie mit dem psychopathischen Drogenboss Tuco Salamanca (Raymond Cruz) aneinander und müssen eine Leiche loswerden, was trotz Einsatz von Säure nicht ganz ohne Spuren gelingt.
Es kommt immer noch tragischer
Immer wenn man denkt, es kann unmöglich noch besser, noch irrer, noch tragischer werden, nimmt „Breaking Bad“ die nächste unfassbare Wendung. Die häufig geäußerte Kritik, die Serie sei zu konstruiert, ist in etwa so sinnvoll, als würde man „Beavis And Butthead“ mangelnde Ernsthaftigkeit vorwerfen. Selten hat man etwas so Erschütterndes und Faszinierendes und visuell Berauschendes gesehen, niemals aber einen so ambivalenten Helden wie Walter White.
Max Gösche